
Aktuelle News.
Kather Augenstein erneut mit 5 Sternen im JUVE Patent Ranking Deutschland 2025 ausgezeichnet
Wir freuen uns, dass Kather Augenstein im kürzlich veröffentlichten JUVE Patent Ranking Deutschland 2025 erneut mit der höchsten Bewertung von 5 Sternen ausgezeichnet wurde.
Diese Anerkennung stärkt unsere Position als eine der führenden Boutique-Kanzleien Deutschlands im Bereich Patentstreitigkeiten. JUVE Patent hebt besonders unsere erfolgreiche Arbeit vor dem Einheitlichen Patentgericht (UPC) hervor und merkt an:
„Die starke Leistung von Kather Augenstein vor dem UPC kommt nicht überraschend. Die Kanzlei hat sich seit Jahren strategisch auf das neue Gericht vorbereitet, was sich sofort ausgezahlt hat, da sie schnell zu einer der aktivsten Kanzleien in UPC-Verfahren wurde.“
Wir freuen uns, dass der Einsatz unseres Teams in den folgenden Ranking-Kategorien besonders gewürdigt wurde:
Prozessführung: Rechtsanwälte – Deutschland 2025
Rechtsanwälte für Patentstreitigkeiten – Deutschland 2025 (führende Persönlichkeiten)
Diese Auszeichnungen spiegeln unser kontinuierliches Engagement für Spitzenleistungen in Patentstreitigkeiten und unsere fundierte technische Expertise in einer Vielzahl von Branchen wider, darunter Mobilkommunikation, Automobilindustrie, Pharmazeutika, Biotechnologie und Chemie.
Ein besonderer Dank gilt unsere Mandanten für ihr anhaltendes Vertrauen, unserem gesamten Team für sein außerordentliches Engagement und seine hervorragende Arbeit sowie dem JUVE Verlag für die Anerkennung.
Wir freuen uns darauf, auch weiterhin wichtige Patentstreitigkeiten in Deutschland, in Europa und vor dem Einheitlichen Patentgericht (EPG) zu gestalten und voranzutreiben.
Besuchen Sie die Seite JUVE Patent Deutschland 2025 hier.
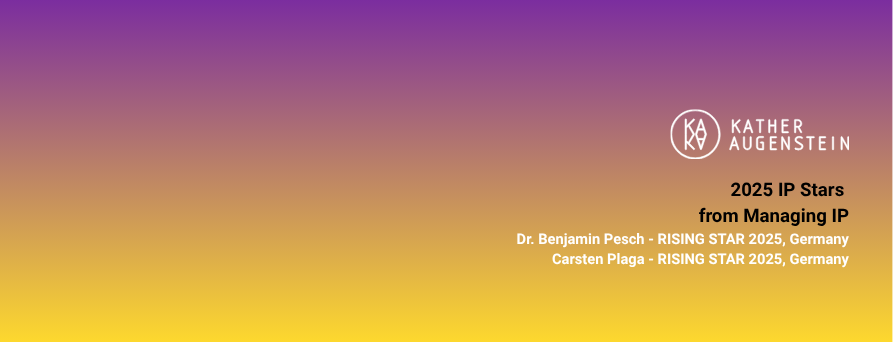
Aktuelle News.
IP Stars – Managing IP ehrt Kather Augenstein Counsel Dr. Benjamin Pesch und Carstenb Plaga als Rising Stars 2025
Wir freuen uns sehr, dass unsere Counsel Dr. Benjamin Pesch und Carsten Plaga im aktuellen Managing IP – IP Stars Ranking 2025 als Rising Stars ausgezeichnet wurden.
Diese renommierte Auszeichnung würdigt junge Anwältinnen und Anwälte, die sich durch besondere Expertise, Engagement und nachhaltige Erfolge im Bereich des geistigen Eigentums auszeichnen.
Dr. Benjamin Pesch wird bereits zum fünften Mal in Folge als Rising Star gelistet – ein deutlicher Beleg für seine beständige Exzellenz vor allem im Bereich des Patentrechts. Sein Fokus liegt in der Beratung nationaler und internationaler Mandanten in der Durchsetzung gewerblicher Schutzrechte, insbesondere im Bereich Telekommunikation und Automotive. Entsprechend hat er in den vergangenen Jahren an mehreren großen Auseinandersetzungen vor nationalen Gerichten und dem Einheitlichen Patentgericht mitgewirkt (zuletzt Panasonic ./. Oppo / Xiaomi). Einen weiteren Schwerpunkt seiner Arbeit bildet die strategische Beratung im Bereich von Lizenzvereinbarungen und die Beratung von Mandantinnen und Mandanten im Falle der Anmeldung von Patenten durch unberechtigte Dritte (Vindikation). Seine wiederholte Auszeichnung unterstreicht seine anerkannte Stellung in der internationalen IP-Community.
Carsten Plaga wurde in diesem Jahr erstmals in die Kategorie Rising Star aufgenommen. Er berät vor allem im Patentrecht, mit einem besonderen Fokus auf Verfahren im Bereich Technologie, Pharma und Life Sciences. Neben seiner Tätigkeit in Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren überzeugt er durch tiefes technisches Verständnis und eine praxisorientierte Beratung auf höchstem Niveau.
Seine Aufnahme in das Ranking spiegelt seine wachsende Sichtbarkeit und die hohe Qualität seiner Arbeit wider. Er hat bereits an zahlreichen Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht (UPC) mitgewirkt und verfügt damit über einen breiten Erfahrungsschatz sowohl in nationalen Patentverletzungsverfahren als auch auf europäischer Ebene,
Mit den beiden Auszeichnung bestätigt Managing IP die Position von Kather Augenstein als führende Boutique für komplexe und streitige IP-Verfahren in Deutschland. Die Ernennung von Dr. Benjamin Pesch und Carsten Plaga zeigt eindrucksvoll die fachliche Stärke und Tiefe unseres Teams.
Wir gratulieren beiden herzlich zu dieser verdienten Auszeichnung!

Aktuelle News.
Zur Reproduzierbarkeit als Voraussetzung nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ – Entscheidung der Großen Beschwerdekammer des EPA vom 02.07.2025 – G 1/23
Die Große Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts (Große Beschwerdekammer) hat am 02.07.2025 die langersehnte Entscheidung in der Sache G 1/23 getroffen.
Hierbei ging es um die Frage, inwieweit ein öffentlich verfügbares Produkt durch die Fachperson reproduzierbar sein muss, um zum Stand der Technik nach Art. 54 Abs. 2 EPÜ zu gehören.
I. Sachverhalt und Fragestellung
Gegenstand des Einspruchsverfahrens war ein Patent, das die technische Lehre zur Verkapselung von Solarzellen schützt. Die Einsprechende sah ein kommerziell verfügbares Polymer als neuheitsschädlich an. Zwischen den Parteien war unstreitig, dass das genaue Herstellungsverfahren nicht allgemein bekannt war. Die Einsprechende argumentierte daher, dass die Fachperson im Stande sei, ein dem verfügbaren Produkt ähnliches Polymer herzustellen. Eine exakte Reproduzierbarkeit könne rechtlich aber nicht verlangt werden. Während die Einspruchsabteilung den Einspruch abwies, legte die Beschwerdekammer der Großen Beschwerdekammer die drei folgenden Fragen vor:
- Is a product put on the market before the date of filing of a European patent application to be excluded from the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC for the sole reason that its composition or internal structure could not be analysed and reproduced without undue burden by the skilled person before that date?
- If the answer to question 1 is no, is technical information about said product which was made available to the public before the filing date (e.g. by publication of technical brochure, non-patent or patent literature) state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC, irrespective of whether the composition or internal structure of the product could be analysed and reproduced without undue burden by the skilled person before that date.
- If the answer to question 1 is yes or the answer to question 2 is no, which criteria are to be applied in order to determine whether or not the composition or internal structure of the product could be analysed and reproduced without undue burden within the meaning of opinion G 1/92?
Auf Deutsch:
- Ist ein Erzeugnis, das vor dem Tag der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung in den Verkehr gebracht wurde, allein deshalb aus dem Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ auszuschließen, weil seine Zusammensetzung oder sein innerer Aufbau von der Fachperson vor diesem Tag nicht ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden konnte?
- Falls die Antwort auf Frage 1 „nein“ lautet: Sind technische Informationen über das genannte Erzeugnis, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht wurden (z. B. durch Veröffentlichung einer technischen Broschüre, Nicht-Patent- oder Patentliteratur), Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ, unabhängig davon, ob die Zusammensetzung oder die innere Struktur des Erzeugnisses vor diesem Tag von der Fachperson ohne unzumutbare Belastung analysiert und reproduziert werden konnte?
- Falls Frage 1 bejaht oder Frage 2 verneint wird, welche Kriterien sind dann anzuwenden, um festzustellen, ob die Zusammensetzung oder die innere Struktur des Erzeugnisses ohne unzumutbaren Aufwand im Sinne der Stellungnahme G 1/92 analysiert und reproduziert werden konnte oder nicht?
II. Erwägungen der Großen Beschwerdekammer
Die Große Beschwerdekammer befasste sich in diesem Zuge nochmals vertieft mit einer Entscheidung aus dem Jahre 1992 (G 1/92). Hier hatte die Große Beschwerdekammer noch entschieden, dass
“The chemical composition of a product is state of the art when the product as such is available to the public and can be analysed and reproduced by the skilled person irrespective of whether or not particular reasons can be identified for analysing the composition.”
Auf Deutsch:
„Die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses entspricht dem Stand der Technik, wenn das Erzeugnis als solches der Öffentlichkeit zugänglich ist und von der Fachperson analysiert und reproduziert werden kann, unabhängig davon, ob besondere Gründe für die Analyse der Zusammensetzung erkennbar sind oder nicht.“
Die Große Beschwerdekammer beobachtete hierbei, dass die Vorlagefrage für die G 1/92-Entscheidung keinen Hinweis auf eine irgendwie geartete Reproduzierbarkeit enthielt. Sie lautete:
Is the chemical composition of a product made available to the public by virtue of the availability to the public of that product, irrespective of whether particular reasons can be identify led to cause the skilled person to analyse the composition?
Auf Deutsch:
“Wird die chemische Zusammensetzung eines Erzeugnisses der Öffentlichkeit dadurch zugänglich gemacht, dass dieses Erzeugnis der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, unabhängig davon, ob besondere Gründe erkennbar sind, die den Fachmann veranlassen, die Zusammensetzung zu analysieren?”
Die Große Beschwerdekammer ging daher zunächst der Frage nach, ob das Merkmal der Reproduzierbarkeit unterschiedlich zu bewerten sei, je nachdem ob man die Reproduzierbarkeit der chemischen Zusammensetzung oder des gesamten Erzeugnisses betrachtete. Die Große Beschwerdekammer kam jedoch zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzung der Reproduzierbarkeit in beiden Auslegungsvarianten nicht (mehr) haltbar sei.
Das Kriterium der Reproduzierbarkeit schaffe eine rechtliche Fiktion, nach der ein tatsächlich frei verfügbares Produkt für die Fachperson nicht existent sei. Dies widerspreche der allgemeinen Lebenserfahrung. Überdies müssten Ausnahmen restriktiv gehandhabt werden und gesetzlich normiert sein. Vorliegend sei aus dem Gesetz nicht ersichtlich, wieso öffentliche Produkte anders behandelt werden sollten als druckschriftlicher Stand der Technik, der – im Gegensatz zu Patentanmeldungen – auch nicht auf seine Ausführbarkeit überprüft werde.
Außerdem würde die Voraussetzung der Reproduzierbarkeit dazu führen, dass auch die Vorprodukte des potenziell neuheitsschädlichen Produkts reproduzierbar sein müssten, da sich die Fachperson für die Frage der Reproduzierbarkeit ebenfalls nur dem Stand der Technik bedienen könnte. Dies würde dazu führen, dass die Fachperson sich nicht nur bestens mit der vertikalen Vertriebskette auskennen müsse, sondern letztlich in der Lage sein müsse, sämtliche Vorprodukte zu reproduzieren, also im Extremfall angefangen auf Atom- und Molekülebene. Die Große Beschwerdekammer verwies beispielhaft auf Rohöl, das Vorprodukt unzähliger Anwendungen sei und dennoch bis heute nicht reproduziert werden könne. Dieses Beispiel zeige, dass die Voraussetzung der Reproduzierbarkeit zu unsachgemäßen Ergebnissen führe.
Die Große Beschwerdekammer unterstrich dabei, dass es zwar theoretisch möglich sei, eine Trennlinie in der Vertriebskette zu ziehen, dies aber angesichts der Vielzahl an technischen Bereichen nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen führen könne.
Daher müsse die Voraussetzung der Reproduzierbarkeit entfallen.
Da damit bereits der zweite Teil des kumulativen Erfordernisses der Vorlagefrage entfiel („analysed and reproduced without undue burden“) kam es nicht mehr darauf an, ob das undue burden Erfordernis auch bei der Analysierbarkeit greife. Die Große Beschwerdekammer ließ zwar anklingen, dass es durchaus Fälle geben könne, in denen die Analysierbarkeit eine unzumutbare Belastung bedeute, ließ dabei aber offen, ob dies Auswirkungen auf die Frage habe, ob ein Produkt zum Stand der Technik gehört oder nicht.
III. Beantwortungen der Vorlagefragen
In der Folge hat die Große Beschwerdekammer die erste Vorlagefrage wie folgt (negativ) beantwortet:
„A product put on the market before the date of filing of a European patent application cannot be excluded from the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC for the sole reason that its composition or internal structure could not be analysed and reproduced by the skilled person before that date.“
Auf Deutsch:
„Ein Erzeugnis, das vor dem Tag der Einreichung einer europäischen Patentanmeldung in den Verkehr gebracht wurde, kann nicht allein deshalb vom Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPÜ ausgeschlossen werden, weil seine Zusammensetzung oder sein innerer Aufbau vom Fachmann vor diesem Tag nicht analysiert und wiedergegeben werden konnte.“
Die zweite Vorlagefrage beantwortet die Große Beschwerdekammer folgerichtig mit „ja“ und führte aus:
„Technical information about such a product which was made available to the public before the filing date forms part of the state of the art within the meaning of Article 54(2) EPC, irrespective of whether the skilled person could analyse and reproduce the product and its composition or internal structure before that date.“
Auf Deutsch:
„Technische Informationen über ein solches Erzeugnis, die der Öffentlichkeit vor dem Anmeldetag zugänglich gemacht wurden, gehören zum Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPÜ, unabhängig davon, ob der Fachmann das Erzeugnis und seine Zusammensetzung oder seinen inneren Aufbau vor diesem Tag analysieren und reproduzieren konnte.“
Da die dritte Vorlagefrage verlangte, dass entweder die erste Frage mit ja oder die zweite mit nein beantwortet worden wäre, ließ die Große Beschwerdekammer diese offen.
IV. Einschätzung
Die Fachperson muss ein Produkt nicht länger reproduzieren können, damit dies zum Stand der Technik gehört. Die Analysierbarkeit ist ausreichend. Dies erhöht die Rechtssicherheit für Dritte. Die Voraussetzungen sind für alle technischen Gebiete identisch und unabhängig von Einzelheiten des konkreten Sachverhalts. Die Große Beschwerdekammer hat sich damit für eine Alles-oder-Nichts-Lösung entschieden und möchte hierdurch Widersprüche vermeiden. Dies gelingt. Auf der anderen Seite schränkt die Entscheidung so die Position von Patentinhabern in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren massiv ein. Die Zukunft wird zeigen, ob nicht doch ein differenzierterer Ansatz erforderlich ist.
Nationale Gerichte verfolgen bisher überwiegend einen restriktiveren Ansatz, auf den auch die AIPPI in ihrem amicus curiae Brief hingewiesen hat.
Im Europäischen Kontext bleibt vor allem abzuwarten, welchen Kurs das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts wählen wird, das sich in der Vergangenheit aufgeschlossen gegenüber EPA-Rechtsprechung gezeigt hat, da diese naturgemäß einen europäisch harmonisierten Ansatz liefert als Entscheidungen nationaler Gerichte.

Aktuelle News.
Internationale Anerkennung: Dr. Christof Augenstein in der Liste der IAM Strategy 300 – The World’s Leading IP Strategists 2025 ausgezeichnet
Kather Augenstein freut sich, bekannt zu geben, dass ihr Partner, Dr. Christof Augenstein, in der Liste der IAM Strategy 300 – The World’s Leading IP Strategists 2025 ausgezeichnet wurde. Diese angesehene Auszeichnung würdigt seine außergewöhnliche strategische Weitsicht und seine herausragenden Leistungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums.
IAM Strategy 300 gilt als maßgeblicher Leitfaden für die weltweit führenden IP-Strategen und umfasst Experten aus renommierten Inhouse-Teams, Anwaltskanzleien und spezialisierten Dienstleistungsunternehmen. Die Aufnahme in diese Liste würdigt Persönlichkeiten, die durch innovative und zukunftsorientierte Strategien im Bereich des geistigen Eigentums einen außergewöhnlichen Mehrwert schaffen.
Die Aufnahme von Dr. Augenstein in diesen renommierten Leitfaden würdigt sein unermüdliches Streben nach Exzellenz sowie sein konsequentes Engagement für die Weiterentwicklung der Innovationslandschaft. Sein strategisches Handeln im Bereich geistigen Eigentums hat ihm international Respekt und hohe Anerkennung unter Fachkollegen eingebracht.“
Kather Augenstein gratuliert Dr. Christof Augenstein herzlich zu dieser herausragenden Auszeichnung und würdigt damit seinen bedeutenden Beitrag zur Weiterentwicklung der Strategien im Bereich des geistigen Eigentums.
Die vollständige Liste der IAM Strategy 300 – The World’s Leading IP Strategists 2025 finden Sie hier.

Aktuelle News.
UPC: Zuständigkeit für Klage gegen mehrere Gesellschaften im In- und Ausland (Lokalkammer München)
Mit Entscheidung vom 20.06.2025 hat die Lokalkammer München des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) über mehrere Einsprüche gegen ihre internationale Zuständigkeit entschieden. Die Entscheidung betrifft eine grenzüberschreitende Patentverletzungsklage gegen vier verschiedene Unternehmen.
1. Sachverhalt
Die Klägerin macht geltend, dass verschiedene Mobilgeräte von ihrem europäischen Patent Gebrauch machen. Die Klage richtete sich gegen: Zwei konzernverbundene Unternehmen mit Sitz in den USA (Beklagte zu 1 und 2), eine deutsche Vertriebsgesellschaft desselben Konzerns (Beklagte zu 3), sowie ein niederländisches Logistikunternehmen (Beklagte zu 5), das angeblich in den Vertrieb der Geräte eingebunden ist.
Die Klägerin hatte mit der Klageschrift Art. 33 (1) lit. b EPGÜ als Grundlage für die Zuständigkeit der Lokalkammer München angeführt. Die Beklagten legten Einspruch nach R. 19 VerfO ein und rügten darin die Zuständigkeit und trugen u.a. vor, es bestehe keine relevante Geschäftsbeziehung zwischen den Beklagten. Die Klägerin ergänzte daraufhin ihren Vortrag im Einspruchserwiderungsschriftsatz um Art. 33 (1) lit. a EPGÜ und verwies auf eine konkrete Lieferung eines Mobilgeräts nach München.
2. Entscheidung der Lokalkammer München
Die Lokalkammer München hat den Einspruch der Beklagten zurückgewiesen. Der Einspruch der Beklagte zu 1 und 2 sei bereits unzulässig, weil die Beklagten zu 1 und 2 den Einspruch erst nach Ablauf der Monatsfrist erhoben haben. Der Einspruch der Beklagten zu 3 und 5 hingegen sei zwar zulässig, aber nicht begründet.
a) Beklagte zu 3 (deutsche Vertriebsgesellschaft)
Hinsichtlich der deutschen Tochtergesellschaft hat die Lokalkammer München ihre die Zuständigkeit unmittelbar aus Art. 33 (1) lit. b Satz 1 EPGÜ abgeleitet. Die Beklagte zu 3 hat ihre Hauptniederlassung in Deutschland, sodass eine deutsche Lokalkammer unabhängig vom konkreten Ort der Verletzungshandlung örtlich zuständig ist. Die weitergehende Rüge der mangelnden Substantiierung der Verletzungsvorwürfe war für die Zuständigkeitsprüfung unbeachtlich.
b) Beklagte zu 1 und 2 (US-amerikanische Gesellschaften)
Die Einsprüche der Beklagten zu 1 und 2 hat das Gericht bereits als unzulässig verworfen. Die Beklagten zu 1 und 2 haben ihre Einsprüche erst nach Ablauf der einmonatigen Frist gemäß Regel 19.1 VerfO eingelegt. Bei Zustellungen außerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten kommt es in jedem Fall auf die tatsächliche Zustellung an, weil die 10-Tages-Fiktion nach R. 271 (6) (b) VerfO nur auf Zustellungen innerhalb und nicht auf außerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten Anwendung findet. Die Beklagten zu 1 und 2 haben die Monatsfrist ausgehend von der tatsächlichen Zustellung der Klageschrift nicht eingehalten.
Ungeachtet dessen das Gericht die Begründetheit des Einspruchs hilfsweise geprüft. Das Gericht stellte fest, dass die Lokalkammer München für die Klage gegen diese beiden Beklagten nach Art. 33 (1) lit. b Satz 2 EPGÜ zuständig ist. Entscheidend war, dass eine der Mitbeklagten (Beklagte zu 3) ihren Sitz in Deutschland hat, zwischen den Beklagten eine Geschäftsbeziehung im Sinne des EPGÜ besteht und derselbe Verletzungsvorwurf erhoben wird. Die Kammer stellte klar, dass die Anforderungen an eine „Geschäftsbeziehung“ nicht zu hoch angesetzt werden dürfen. Eine konzerninterne Verbundenheit und arbeitsteilige Tätigkeit im Rahmen des Vertriebs genügen bereits.
c) Beklagte zu 5 (niederländisches Logistikunternehmen)
Die Lokalkammer München bejahte die Zuständigkeit für die Beklagten zu 5 wahlweise auf Grundlage von Art. 33 Abs. 1 lit. b Satz 2 oder lit. a EPGÜ. Zwar gehört die Beklagte zu 5 nicht demselben Konzern an wie die anderen Beklagten an, dennoch stellte das Gericht fest, dass eine Geschäftsbeziehung im Sinne von Art. 33 (1) lit. b Satz 2 EPGÜ gegeben sei, weil das Unternehmen als Logistikdienstleister europaweit für den Konzern tätig ist.
Hilfsweise bejahte das Gericht auch die Zuständigkeit gemäß Art. 33 (1) lit. a EPGÜ, weil die Beklagte zu 5 die Geräte auch nach Deutschland geliefert hat. Das Gericht betonte in diesem Zusammenhang, dass es für die Zuständigkeitsprüfung nicht auf den Beweis der Verletzung ankäme, sondern lediglich der Vortrag der Klägerin maßgeblich sei.
Dem steht auch nicht entgegen, dass sich die Klägerin mit der Klageschrift nur auf eine Zuständigkeit nach Art. 33 (1) lit. b EPGÜ gestützt hat. Zwar setzt R. 13.1 (n) VerfO voraus, dass die Klägerin rechtliche Ausführungen bereits mit der Klageschrift machen muss. Dies setze aber nicht voraus, dass die Klägerin alle möglichen Verteidigungslinien vorwegnehmen muss. R. 13.1 (n) VerfO schließe nicht aus, dass die Klägerin ihren Vortrag im weiteren Verlauf konkretisiert bzw. auf Einwendungen seitens der Beklagten eingeht.
3. Fazit
Die Entscheidung der Lokalkammer München steht im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung des UPC und zeigt auf, dass das UPC ein Forum ist, um grenzüberschreitende Patentverletzungsverfahren effizient an einem Ort zu bündeln. Die Entscheidung gibt insbesondere zu folgenden Punkten praxisrelevante Hinweise:
Die Frist zur Einlegung eines Einspruchs beginnt bei Zustellungen außerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten mit der tatsächlichen Zustellung. Einträge im CMS sind nicht maßgeblich.
Die Anforderungen an eine „Geschäftsbeziehung“ im Sinne von Art. 33 Abs. 1 lit. b Satz 2 EPGÜ sind weit zu verstehen und schließen konzerninterne sowie logistische Verbindungen ein.
Es ist grundsätzlich möglich sich auf zusätzliche Zuständigkeitsvorschriften im Laufe des Verfahrens zu berufen, auch wenn sie in der Klageschrift nicht ausdrücklich genannt wurden. Im Sinne der anwaltlichen Vorsicht, sollten aber möglichst zu beiden in Art. 33 (1) EPGÜ geregelten Zuständigkeitstatbeständen bereits in der Klageschrift vorgetragen werden.

Aktuelle News.
Kather Augenstein ernennt Carsten Plaga zum 1. Juli 2025 zum Counsel
Seit 2018 ist Carsten Plaga Teil des Teams von Kather Augenstein und berät nationale wie internationale Mandanten umfassend im Patent- und Gebrauchsmusterrecht.
Seine fachliche Spezialisierung legte Carsten Plaga bereits im Studium an der Universität Osnabrück mit dem Schwerpunkt „Deutsches und Europäisches Recht des Wettbewerbs und des geistigen Eigentums“. Während seines Referendariats sammelte er praxisnahe Erfahrungen in einer international tätigen IP-Kanzlei in Düsseldorf sowie in einer mittelständischen Sozietät aus Patent- und Rechtsanwälten in Osnabrück.
Carsten Plaga ist aktives Mitglied der der Deutschen Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR) sowie des Centrums für Unternehmensrecht Osnabrück (CUR) und der International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI). Er hält regelmäßig Fachvorträge, unter anderem an der Deutschen Anwalt Akademie.
„Mit Carsten Plaga haben wir einen engagierten Kollegen, der durch seine Fachkompetenz und seinen unermüdlichen Einsatz für unsere Mandanten überzeugt“, sagt Miriam Kiefer, Managing Partner bei Kather Augenstein. „Seine Ernennung ist Ausdruck seiner bisherigen Leistungen, darunter die Planungsphase unserer Kanzlei für das UPC-Case Management System, ebenso wie unseres Vertrauens in seine weitere erfolgreiche Arbeit.“

Aktuelle News.
Handelsblatt / Best Lawyers: Die besten Anwälte Deutschlands 2025 Kather Augenstein erneut ausgezeichnet in den Kategorien Gewerblicher Rechtsschutz und Konfliktlösung
Das Handelsblatt hat in Zusammenarbeit mit dem renommierten US-amerikanischen Fachverlag Best Lawyers in der 17. Auflage sein jährliches Ranking der führenden Anwältinnen und Anwälte in Deutschland veröffentlicht. Erneut wurde Kather Augenstein in den Bereichen gewerblicher Rechtsschutz sowie Konfliktlösung (Litigation) gelistet.
Besonders freuen wir uns über die persönliche Auszeichnung von Dr. Peter Kather, Dr. Christof Augenstein, Miriam Kiefer LL.M., Christopher Weber und Sören Dahm, die jeweils in ihrem Fachgebiet im Bereich des gewerblicher Rechtsschutz zu den besten Anwälten Deutschlands zählen. Ebenfalls im Bereich gewerblicher Rechtsschutz wurde in diesem Jahr Dr. Benjamin Pesch in der Kategorie Ones to Watch – Anwälte der Zukunft ausgezeichnet. Diese Auszeichnung wird an Anwälte vergeben, die sich in ihrer noch jungen Karriere durch besondere Leistungen hervorgetan haben. Sie sind in der Regel seit 3-8 Jahren in der Praxis tätig.
Zudem wurden Dr. Christof Augenstein und Christopher Weber im Bereich Konfliktlösung (Litigation) als beste Anwälte in Deutschland gelistet.
Das Ranking basiert auf einer unabhängigen Peer-Review-Befragung unter Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die Empfehlungen außerhalb der eigenen Kanzlei aussprechen. Diese Auszeichnung stellt somit sowohl ein bedeutendes Qualitätssiegel als auch eine hohe fachliche Anerkennung innerhalb der Branche dar.
Wir danken unseren Mandantinnen und Mandanten für ihr fortwährendes Vertrauen und unseren Kolleginnen und Kollegen für die besondere Wertschätzung.

Aktuelle News.
Neueste Rechtsprechung des Einheitlichen Patentgerichts zu einstweiligen Maßnahmen
Das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) hat in einer Reihe von Entscheidungen seine Rechtsprechung zu einstweiligen Maßnahmen konkretisiert.
I. UPC_CoA_540/2024, 24.02.2025 – Notwendigkeit
Das Berufungsgericht unterstreicht in dieser Entscheidung, die zwischen Wettbewerbern im medizintechnischen Sektor ergangen ist, dass für den Erlass von einstweiligen Maßnahmen erforderlich ist, dass nachweislich der Ausgang der Hauptsache nicht abgewartet werden kann (sog. Notwendigkeit). Dies ergebe sich explizit aus dem 22. Erwägungsgrund der Durchsetzungsrichtlinie (2004/48/EG). Ein lediglich summarischer Prüfungsumfang sei nur gerechtfertigt, wenn die Hauptsache nicht abgewartet werden könne, etwa wenn ein nicht wiedergutzumachender Schaden drohe, wobei dies keine zwingende Voraussetzung sei.
Im konkreten Fall sah das Berufungsgericht keine Notwendigkeit für den Erlass einstweiliger Maßnahmen, weil die Patenterteilung in bestehende Wettbewerbsverhältnisse erfolgte. Das angegriffene Produkt war bereits seit Jahren auf dem Markt, weshalb es der Antragstellerin nicht gelang, nachzuweisen, dass dieser „status quo“ nun einstweilen geändert werden müsse und hierfür die Hauptsache nicht abgewartet werden könne.
Auch weitere Versuche der Antragstellerin die Notwendigkeit ihres Anliegens nachzuweisen, blieben erfolglos. So könne laut dem Berufungsgericht aus einer Messeteilnahme im letzten Jahr nicht gefolgert werden, dass das Produkt dort auch im bevorstehenden Termin ausgestellt werde. Die Antragstellerin müsse nachweisen, dass das konkrete Produkt auf der Messe tatsächlich ausgestellt werde. Auch gelang es der Antragstellerin nicht, nachzuweisen, dass die Produkte typischerweise bevorratet würden, was zu einem längeren Nachfrageverlust führe. Die Antragsgegnerin belegte, dass mittlerweile ein Substitut vorhanden sei und das angegriffene Produkt nicht mehr in größeren Mengen vertrieben werde.
Bezüglich vergangener Ausschreibungen von Großkunden sei ebenfalls nicht ausreichend nachgewiesen worden, dass hier jeweils der Zuschlag zugunsten der Antragsgegnerin und zulasten der Antragstellerin erfolgte.
Die Entscheidung ist eine Warnung an Antragstellerinnen einstweiliger Maßnahmen die Darlegungslast zur Notwendigkeit ihres Anliegens nicht zu unterschätzen. Gerade Messen sind häufig Ausgangspunkt patentrechtlicher Streitigkeiten. Wie diskutiert verlangt das Berufungsgericht hier den Nachweis, dass das konkret angegriffene Produkt tatsächlich ausgestellt werden wird oder ausgestellt wird.
II. UPC_CoA_523/2024, 03.03.2025 – Erstbegehungsgefahr
In einem weiteren Verfahren konnte die Antragsstellerin eine einstweilige Unterlassungsverfügung gegen eine Wettbewerberin und ihr Herbizid erstreiten. Das Berufungsgericht bestätigte die Anordnung. Die Besonderheit des Falles lag darin, dass die Antragsstellerin Unterlassung in allen Ländern forderte, in denen ihr europäisches Patent validiert war, die Antragstellerin aber noch nicht in all diesen Ländern eine behördliche Zulassung für ihren Unkrautvernichter erlangen konnte.
Die Lokalkammer Düsseldorf hatte in vorangegangenen Entscheidungen (CFI_165/2024 und CFI_166/2024 vom 06.09.2024) noch entschieden, dass keine Erstbegehungsgefahr bestünde, wenn noch keine Marktzulassung für ein pharmazeutisches Produkt bestünde. Dies sei jedoch immer anhand einer Gesamtwürdigung des Einzelfalles zu betrachten.
Und in der Tat unterscheidet sich die aktuelle Entscheidung des Berufungsgerichts darin, dass bereits eine Marktzulassung zumindest in einzelnen Staaten des EPG-Raumes vorlag. Daher bestehe das Risiko, dass derartige Marktzulassungen zukünftig für weitere EPG-Staaten gewährt werden könnten und der Vertrieb ausgeweitet würde.
Die Entscheidung fügt sich damit in das bisherige Rechtsprechungsgefüge ein. Sie ist praxisorientiert und bietet Patentinhabern den Schutz, den sie sich von einem multinationalen Gericht erhoffen, da die rechtliche Prüfung nicht an den Staatengrenzen endet. Da die Problematik der Erstbegehungsgefahr bei fehlender Marktzulassung häufig bei pharmazeutischen Produkten auftritt, kann sich der Praktiker hier das Schlagwort der „Infektionsgefahr“ merken. Die Markzulassung in einzelnen Validierungsstaaten ist ausreichend, um auch weitere mit der Erstbegehungsgefahr zu infizieren.
III. UPC_CoA_382/2024 14.02.2025 – Allgemeinverfügung und Auskunft
In der letzten hier besprochenen Entscheidung bestätigte das Berufungsgericht eine sogenannte Allgemeinverfügung. Der Antragsgegnerin wurde aufgegeben sämtliche patentverletzenden Handlungen zu unterlassen, obwohl bisher keine Herstellung patentverletzender Produkte im Inland erfolgte. Dieser Ansatz ist beispielweise den nationalen Gerichten in Deutschland fremd, welche die Erstbegehungs- und Wiederholungsgefahr nur für solche Handlungen annehmen, welche schon erfolgten, unmittelbar bevorstehen oder in der Vertriebskette nachgelagert erfolgen. Hiernach wird die Herstellung daher üblicherweise nicht untersagt, wenn bisher nur vertrieben wird.
Das Berufungsgericht folgt damit dem Vorbild britischer und niederländischer Gerichte, welche eine derartige Allgemeinverfügung in jedweder Art bei erstmaligem Verstoß kennen. Es verwundert daher nicht, dass die Entscheidung vom zweiten Berufungssenat unter dem Vorsitz der Niederländerin Rian Kalden nach erstinstanzlicher Entscheidung durch die Lokalkammer Den Haag erfolgte.
Die Entscheidung bestätigt zudem, dass Antragsteller auch im einstweiligen Verfahren eine Auskunft nach Art. 67 EPGÜ erhalten können, um die weiteren Vertriebswege aufzudecken. Das Berufungsgericht macht aber deutlich, dass hierzu in der Regel keine Preisauskünfte zählen dürften. Diese seien vordringlich zur Bestimmung des Schadensersatzes in Anschluss an das Hauptsacheverfahren relevant.
Gerade für deutsche Praktiker bedeutet dies ein Wechsel des gewohnten Fahrwassers. § 140b Abs. 3 iVm. Abs. 7 PatG räumt dem Gericht gerade kein Ermessen ein („hat Angaben zu machen“). In der Folge wurden auch von deutschen Gerichten üblicherweise Antragsgegnerin im Wege einstweiliger Verfügungen aufgegeben, Preisauskünfte zu leisten.
Daher wird § 140b PatG von Teilen der Literatur insofern als Umsetzungsfehler der Durchsetzungsrichtlinie angesehen (vgl. etwa: Ann, 22. Auflage, § 35, Rz. 105). Es erscheint unbillig, dem Patentinhaber Preisinformationen zu übermitteln, die ihm ermöglichen, wettbewerbsverzerrende Angebote abzugeben, obwohl die Patentverletzung noch nicht in der Hauptsache festgestellt worden ist.
Dies führt das Einheitliche Patentgericht nicht fort und macht schulbuchmäßig vom seinem nach Art. 67 EPGÜ eingeräumten Ermessen Gebrauch.

Aktuelle News.
Zur territorialen Reichweite des Unterlassungsanspruchs und die Darlegungs- und Beweislast für den Kläger (R. 13m VerfO und R. 171.1 VerfO), Lokalkammer Paris, Urt. v. 24.04.2025, UPC_CFI_440/2023)
In einem Verfahren betreffend einer Verletzungsklage hatte sich die Lokalkammer Paris mit der Frage der Darlegungs- und Beweislast der Klägerin hinsichtlich der Verletzungshandlungen der Beklagten in einzelnen Mitgliedstaaten zu befassen.
Sachverhalt
Gegenstand des Verfahrens war eine Klage gegen ein französisches Unternehmen, das einer europäischen Vertriebsgruppe angehört. Sie vertreibt in Frankreich UVC-LED-Chips, die die Klägerin für patentverletzend hält. Die Herstellerin und Lieferantin der Beklagten, eine Gesellschaft koreanischen Rechts, trat dem Rechtsstreit auf Antrag der Beklagten bei. Die Klägerin ist Inhaberin des Klagepatents. Sie beantragte Unterlassung für das französische, deutschen, niederländische und britische Hoheitsgebiet. Die Klägerin legte die Verletzungshandlung in Frankreich dar, indem sie einen Screenshot von der französischen Vertriebsseite vorlegte. Zudem tätigte sie einen Testkauf in Frankreich über die französische Website. Die Beklagte bestritt die Verletzungshandlung als solche für keines der von dem Klageantrag umfassten EPGÜ-Staaten.
Entscheidung der Lokalkammer
Die Lokalkammer stellte die Patentverletzung fest und verurteilte die Beklagte unter anderem zur Unterlassung. Der Verbotstenor war jedoch nur auf das Gebiet Frankreichs beschränkt, während die Lokalkammer den Unterlassungsantrag hinsichtlich Deutschland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich abwies.
Die Lokalkammer begründete die teilweise Klageabweisung mit fehlender Substanziierung der Verletzungshandlungen für Deutschland, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich. Es obliege dem Kläger nach R. 13m VerfO sowie R. 171.1 VerfO Nachweis über alle Tatsachen hinsichtlich der behaupteten Verletzungshandlungen zu erbringen. Die Klägerin hat jedoch nur einen Testkauf in Frankreich vorgenommen, nicht aber für die übrigen beantragten EPGÜ-Staaten und dem Vereinigten Königreich. Die von der Klägerin vorgelegten Auszüge der Website lassen eine Sektorisierung der Verkaufsgebiete erkennen. Damit hat die Klägerin nicht dargelegt und bewiesen, dass auch Verletzungshandlungen in den drei anderen Ländern durch die Beklagte vorgenommen werden. Denn obwohl es sich insgesamt um eine europäische Vertriebsgruppe handelt, ist die Klägerin nur gegen die französische Beklagte vorgegangen.
Fazit
Die Entscheidung der Lokalkammer Paris überrascht. Sie widerspricht Art. 34 EPGÜ, wonach die Entscheidung im Falle eines europäischen Patents für das Hoheitsgebiet derjenigen Vertragsmitgliedstaaten gilt, für die das europäische Patent Wirkung hat (so auch: Court of Appeal, Entscheidung vom 30.04.2025, UPC_CoA_768/2024 Rn. 124 ff.). Denn verletzt das Produkt das Klagepatent, dann ist das regelmäßig in allen Mitgliedstaaten der Fall. Es ist gerade der herausstechende Vorteil des Einheitspatentgerichts, dass Gerichte umfassende Kognitionsbefugnis besitzen. Eine Ausnahme wird nur dann gemacht, wenn bestimmte Umstände dies rechtfertigen. Möglicherweise hat die Lokalkammer Paris eine solche Ausnahme hier angenommen, weil die Klägerin sich – trotz eines unstreitig bestehenden Vertriebsnetzes – nur auf ein Unternehmen der europäischen Vertriebsgruppe beschränkt hat. Hierzu fehlen dann jedoch weitere Erwägungen. Zudem erscheint es als ein falscher Ansatzpunkt, da bei der missglückten Wahl der Beklagten keine Bindungswirkung für die übrigen Unternehmen entstünde, sondern nur das französische Unternehmen die Produkte nicht mehr vertreiben dürfte. Für alle anderen tatsächlichen Verkäufe in den anderen beantragten Ländern hätte die Klägerin schlicht eine neue Klage erheben müssen. Vor diesem Hintergrund erscheint eine Ausnahme von Art. 34 EPGÜ in diesem Fall nicht zielführend zu sein.
Die Lokalkammer Paris begründet die Entscheidung mit R. 13m VerfO und R. 171.1 VerfO. Die Klägerin sei ihrer Darlegungs- und Beweislast nicht nachkommen, weil sie die Verletzungshandlungen nicht für jeden Mitgliedstaat gesondert dargelegt hat. Eine solche Auslegung der Beweisregeln widerspricht jedoch dem oben skizzierten Grundsatz. Dies gilt umso mehr, da die Beklagte die Verletzungshandlungen für die übrigen Vertragsstaaten nicht bestritten hat. Es wäre daher stringenter und auch prozessökonomischer gewesen, wenn die Lokalkammer die Unterlassung für sämtliche beantragten Vertragsstaaten tenoriert hätte und das hier offensichtliche Störgefühl der falschen Beklagtenauswahl über die inter partes Wirkung des Urteils zu lösen.
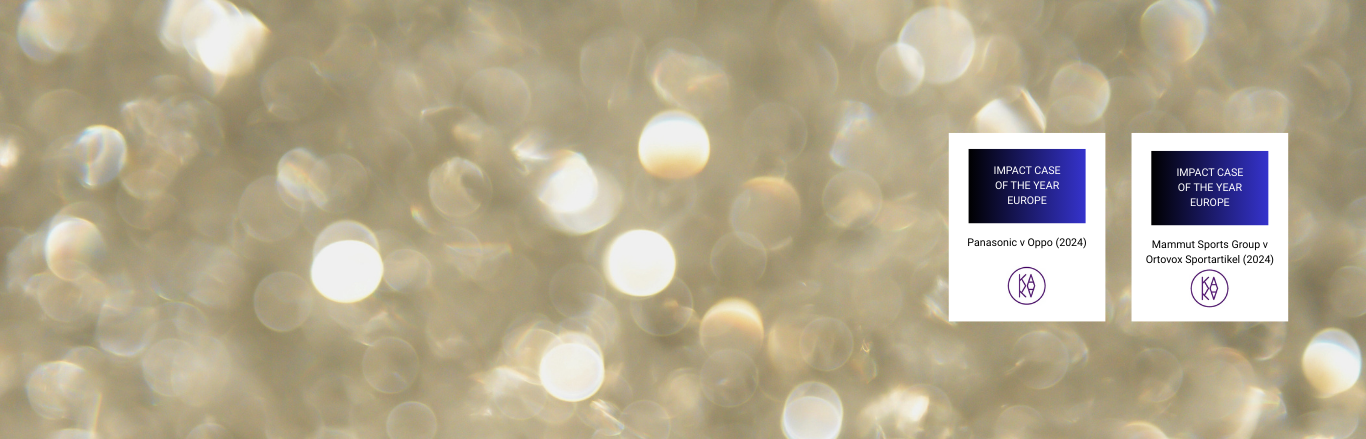
Aktuelle News.
Doppelter Erfolg für Kather Augenstein bei den Managing IP EMEA Awards 2025
Kather Augenstein wurde bei den 20. Managing IP EMEA Awards 2025 in London gleich doppelt ausgezeichnet – mit dem „Impact Case of the Year Europe – Panasonic v OPPO (2024)“ sowie dem „Impact Case of the Year Europe – Mammut Sports Group v Ortovox Sportartikel (2024)“ – und zählt damit erneut zu den führenden Kanzleien im europäischen IP-Recht.
Mit den Managing IP EMEA Awards werden jedes Jahr diejenigen Inhouse-Teams, Kanzleien, Rechtsanwälte und Unternehmen gewürdigt, die für die innovativste und anspruchsvollste Arbeit im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes im vergangenen Jahr maßgeblich verantwortlich sind, sowie diejenigen, die den internationalen Markt vorantreiben.
Miriam Kiefer LL.M. kommentiert die beiden Auszeichnungen: „Mit unserem herausragenden Team haben wir den wegweisenden Fall Panasonic vs. Xiaomi und OPPO erfolgreich vor dem Einheitlichen Patentgericht (EPG) geführt. Dass wir dabei den ersten SEP/FRAND-Fall vor dem EPG gewinnen konnten, ist ein bedeutender Meilenstein – für unsere Boutique-Kanzlei ebenso wie für das europäische Patentrecht insgesamt. Auch mit Ortovox vs. Mammut konnten wir Geschichte schreiben: Wir haben nicht nur die erste einstweilige Verfügung vor dem EPG erwirkt, sondern auch in der Berufung erfolgreich verteidigt. Diese Erfolge bestätigen unsere Position als eine der führenden Kanzleien vor dem EPG.“
Für unser Team ist diese doppelte Auszeichnung eine bedeutende Anerkennung unseres Engagements und der Leidenschaft, mit der wir unsere Mandate führen. Wir danken unseren Mandanten, Kollegen und allen, die uns unterstützen, aufs Herzlichste.
Detaillierte Hintergrundinformationen finden Sie hier.
