
Aktuelle News.
BGH, Urteil v. 20.06.2023 – X ZR 61/21 – Faserstoffbahn
Wann sind die Grenzen des Vorbenutzungsrechts überschritten, wenn eine Modifikation verwendet wird? Mit dieser Frage hat sich der 10. Zivilsenat in der Entscheidung Faserstoffbahn auseinandergesetzt.
I. Sachverhalt
Das Verletzungsverfahren hatte eine Slipeinlage der Beklagten (zunächst angegriffene Ausführungsform I) zum Gegenstand. Das LG Düsseldorf hat die Beklagte im Wesentlichen antragsgemäß verurteilt. In der Berufungsinstanz vor dem OLG Düsseldorf beschränkte der Kläger die Klage auf die Ausführungsform II, die erstmals superabsorbierende Stoffe (SAP) aufwies, wobei er eine Kombination aus Haupt- und Unteransprüchen geltend machte.
Das OLG Düsseldorf hat das geltend gemachte Vorbenutzungsrecht verneint und die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, dass die vorbenutzte Slipeinlage unstreitig keine SAP aufgewiesen habe. Der Vorbenutzer sei jedoch auf die Nutzung desjenigen Besitzstands beschränkt, den er vor dem Anmelde- bzw. Prioritätstag genutzt habe. Folglich sei schon kein geschützter Besitzstand in Bezug auf die zuletzt geltend gemachte Anspruchsfassung gegeben – die Frage nach der Reichweite eines Vorbenutzungsrechts bei Modifikationen stelle sich daher nicht.
Auf die Revision der Beklagten hat der BGH das Berufungsurteil aufgehoben und zur erneuten Entscheidung und Verhandlung in der Sache an das OLG Düsseldorf zurückverwiesen.
II. Begründung
Der Vorbenutzer sei grundsätzlich auf die Nutzung desjenigen Besitzstands beschränkt, für den vor dem Anmelde- oder Prioritätstag sämtliche Voraussetzungen des Ausnahmetatbestands erfüllt waren. Weiterentwicklungen über diesen Besitzstand hinaus sind ihm verwehrt, wenn sie in den Gegenstand der geschützten Erfindung eingriffen. Ob eine andere Benutzungsform vorliege, sei am Maßstab der unter Berücksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen ausgelegten Schutzansprüche zu beurteilen.
Der Vorbenutzer überschreite insbesondere die Grenze seines Vorbenutzungsrechts, wenn mit der Modifikation erstmals ein zusätzlicher Vorteil erzielt werde. Anders verhalte es sich dagegen, wenn das Patent bzw. Gebrauchsmuster eine Abweichung von der Vorbenutzung offenbare, die der Fachmann zum Anmelde- oder Prioritätszeitpunkt ohne Weiteres in Betracht gezogen hätte.
Diese Prüfung habe das Berufungsgericht jedoch nicht vorgenommen, sondern sei rechtsfehlerhaft davon ausgegangen, dass sich die Frage der Reichweite aufgrund einer Modifikation hier grundsätzlich nicht stelle.
Die Modifikation eines vorbenutzten Gegenstands, der alle Merkmale eines unabhängigen Anspruchs des Klagegebrauchsmusters verwirkliche, könne allerdings auch dann von einem Vorbenutzungsrecht gedeckt sein, wenn der vorbenutzte Gegenstand weitere Merkmale nicht aufgewiesen habe, die nach dem Klageantrag zwingend seien. Das gelte unabhängig davon, ob lediglich die Verletzungsklage auf eine in der genannten Weise beschränkte Fassung eines unabhängigen Schutzanspruchs gestützt werde oder ob das Gebrauchsmuster in einem Löschungsverfahren entsprechend beschränkt worden sei.
III. Fazit
Verwirklicht eine Modifikation erstmals zusätzliche Merkmale eines Unteranspruchs, sind die Grenzen des Vorbenutzungsrechts nicht per se überschritten. Im Einzelfall kann dies zwar dafürsprechen, dass ein zusätzlicher Vorteil erreicht wird, der nicht mehr von dem Vorbenutzungsrecht gedeckt ist. Das ist allerdings anhand des Patents bzw. Gebrauchsmusters in seiner erteilten Fassung zu prüfen.

Aktuelle News.
Aluminiumdielen – OLG Karlsruhe Beschluss 18.07.2023 – 6 W 30/23
In seinem Beschluss vom 18.07.2023 hat das OLG Karlsruhe sich sowohl mit der Vollstreckung nach § 888 ZPO als auch mit der Frage beschäftigt, ob ein schutzrechtsverletzender Gegenstand noch innerhalb der Vertriebswege ist, wenn dieser sich bei einem Gewerbetreibenden befindet, der kein Händler ist.
Der Sachverhalt
Beim vorliegenden Fall handelte es sich um eine Beschwerde gegen ein Urteil des LG Mannheim (Beschluss vom 19. Mai 2023, Az. 2 O 86/21 ZV II). In diesem entschied das LG Mannheim, dass die Schuldnerinnen die in Frage stehenden „Outdoor-Aluminiumdielen“ „zurückzurufen oder endgültig aus den Vertriebswegen zu entfernen“ haben. Die Schuldnerinnen wehren sich dagegen mit dem Argument, dass sich keine Produkte mehr in den Vertriebswegen befänden und daher ein Rückruf unmöglich sei. Dies begründen Sie damit, dass alle in den Verkehr gebrachten Erzeugnisse bereits verbaut wurden und damit in das Eigentum der Endabnehmer übergegangen seien.
Der Beschluss
In dem Beschluss stellt das LG Karlsruhe neben der Zulässigkeit des Antrages zunächst fest, dass eine Verurteilung zu Rückruf oder Entfernen nach § 888 ZPO zu vollstrecken ist. Dies begründet die Kammer damit, dass der Wortlaut des Urteils „oder“ den Schuldnerinnen die Möglichkeit lässt, zwischen den beiden Optionen zu wählen. Da zumindest der Rückruf eine nicht vertretbare Handlung im Sinne des § 888 ZPO ist, ist eine Vollstreckung – unabhängig von der Vertretbarkeit der weiteren Option – nach § 888 ZPO zu vollziehen. Ob die wahlweise angeordnete Entfernung aus dem Vertriebswegen auch eine nicht vertretbare Handlung darstellt oder aus § 887ZPO als nicht vertretbare Handlung zu vollziehen ist, ist laut der Kammer irrelevant.
In Bezug auf die materiellrechtlichen Fragen der Entscheidung ist vorliegend § 140a Abs. 3 S. 1 PatG zu beachten. Gem. § 140a Abs. 3 S. 1 PatG können Verletzte, deren Erfindungen entgegen den §§ 9 bis 13 PatG benutzt werden, von den Verletzenden den Rückruf der Erzeugnisse oder das endgültige Entfernen aus den Vertriebswegen verlangen.
Bezüglich der Frage, wann ein verletzter Gegenstand sich noch in den Vertriebswegen befindet, stellt das OLG Karlsruhe in der vorliegenden Entscheidung auf den Begriff des privaten Endverbrauchers ab. Die Kammer stellt klar, dass ein verletzender Gegenstand auch dann noch „in den Vertriebswegen“ ist, wenn es sich bei dem Abnehmer um einen Gewerbetreibenden handelt, der kein Händler ist. Diese Entscheidung begründet das OLG Karlsruhe damit, dass es denkbar sei, dass eine Sache später im Rahmen einer gewerblichen Handlung veräußert wird und dadurch eine patentverletzende Handlung ausgeübt wird. Im vorliegenden Fall argumentiert die Kammer, dass die Immobilie, in welche der „Outdoor-Aluminiumboden“ verbaut wurde, im weiteren Verlauf von dem Gewerbetreibenden als gewerbliche Handlung veräußert werden könnte. Durch diese Umstände kommt das Gericht zu dem Schluss, dass eine Weiterveräußerung der Dielen nicht hinreichend ausgeschlossen ist. Auch der Einwand der Schuldnerinnen, dass die Produkte bereits bei den Abnehmern verbaut sind, rechtfertigte aus Sicht des Gerichts keine andere Entscheidung. Dies begründete das Gericht damit, dass der Rückruf gem. § 140a Abs. 3 S. 1 PatG lediglich eine dem Schuldner obliegende Aufforderung an den Abnehmer ist, die gelieferten Erzeugnisse zurückzugeben, es hat keine Auswirkungen für den Schuldner, ob die Abnehmer der Aufforderung tatsächlich Folge leisten oder nicht. Der Schuldner ist seiner Rechtspflicht nachgekommen, wenn er die Aufforderung ausgesprochen hat. Dem Rückruf steht nicht entgegen, dass ein Ausbau mit einem einzelnen Vertrieb der Dielen sehr unwahrscheinlich ist.
In seiner früheren Rechtsprechung hatte das LG Mannheim genau dies anders gesehen. Es stellte in der Entscheidung vom 10.12.2013, Az. 2 O 180/12 fest, dass die Endabnehmer/Endnutzer nicht zum Vertriebsweg gehören. Dabei sollte es gleich sein, ob diese den Gegenstand gewerblich nutzen oder nicht. Gegenstände, die sich bei privaten oder gewerblichen Abnehmern befinden, sind nicht mehr innerhalb der Vertriebswege, wenn die Abnehmer als „Endabnehmer“ einzustufen sind.
Das OLG Karlsruhe hat seine Entscheidung unter anderem auf frühere Entscheidungen des OLG Düsseldorfs gestützt. Die Entscheidungen des OLG Düsseldorfs kommen ebenfalls zu dem Ergebnis, dass Gegenstände grundsätzlich noch in dem Vertriebsweg sind, wenn sie sich bei einem gewerblichen Abnehmer befinden. Auch hier stellt das Gericht fest, dass es keinen Unterschied macht, ob der gewerbliche Abnehmer als Endabnehmer einzustufen ist oder nicht.
Im Urteil vom 15.07.2021 – 15 U 42/20 begründete das OLG Düsseldorf seine Entscheidung damit, dass ein gewerblicher Endverbraucher ein Patent grundsätzlich verletzt, wenn er das patentverletzende Erzeugnis gewerblich nutzt. In diesem Fall besitzt er das patentverletzende Erzeugnis zum Zwecke der Nutzung gem. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG.
Auch in dem Urteil vom 13.08.2020 – 2 U 10/19 kam das OLG Düsseldorf zu dem Ergebnis, dass ein Produkt auch dann noch „in den Vertriebswegen“ ist, wenn es sich bei einem gewerblichen Endabnehmer befindet. In dem vorliegenden Fall stritten die Parteien sich um Zündkerzen in einem Gasmotor und auch hier argumentierte das Gericht, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass der mit den Zündkerzen ausgerüstete Motor gebraucht verkauft wird und die patentverletzenden Zündkerzen damit einhergehend auch gewerblich genutzt werden. Zudem stellt das OLG Düsseldorf fest, dass ein Produkt nur dann nicht „in den Vertriebswegen“ ist, wenn ausgeschlossen werden kann, dass es zu einem späteren Zeitpunkt weitervertrieben wird.
Die genannten Argumente des OLG Düsseldorf nimmt das OLG Karlsruhe auf und wendet diese auf den eigenen Fall an.
Mit dem vorliegenden Urteil schließt sich das OLG Karlsruhe somit der bereits vorliegenden Rechtsprechung des OLG Düsseldorfs an.

Aktuelle News.
The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law Review – Update: Christopher Weber und Dr. Benjamin Pesch geben Einblicke zu jüngsten Entwicklungen des geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts im pharmazeutischen Sektor in Deutschland
Auch in diesem Jahr haben unser Partner Christopher Weber und unser Counsel Dr. Benjamin Pesch in der 4. Ausgabe der Fachpublikation The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law Review aufgrund ihrer Expertise im Pharmabereich ein weiteres Kapitel zu den aktuellen Entwicklungen im deutschen Markt veröffentlicht.
In Kapitel 5 geben sie einen aktuellen Überblick zu den allgemeinen Grundsätzen und jüngsten Entwicklungen im Bereich des geistigen Eigentums und des Wettbewerbsrechts im Arzneimittelbereich in Deutschland. Einen detaillierten Einblick in das deutsche Kapitel erhalten Sie hier.
Auszüge der Publikation werden auch im Rahmen unserer Partnerschaft auf Lexology veröffentlicht. Bei Interesse eines gebundenen Buchexemplars stehen Ihnen unsere beiden Autoren zur Verfügung:
weber@katheraugenstein
pesch@katheraugenstein
Die 4. Ausgabe von The Pharmaceutical Intellectual Property and Competition Law Review ist ein jährlich erscheinender, gebunden und online verfügbarer Leitfaden zu rechtlichen und marktbezogenen Entwicklungen in den wichtigsten Rechtsordnungen im pharmazeutischen Sektor weltweit.
Er dient als ein nützliches Instrument für das Management globaler Risiken in diesem Bereich und analysiert die Schlüsselelemente der relevanten rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in den wichtigsten Rechtsordnungen weltweit. Die Publikation deckt mit ihren insgesamt 12 Kapiteln viele wichtige europäische und internationale Jurisdiktionen ab.
Zu the Law Reviews:
The Law Reviews ist ein Expertennetzwerk, das über 108 Rechtsgebiete in mehr als 130 Ländern weltweit abdeckt und sich an Praktiker wendet, die über ihre eigenen Grenzen hinauszublicken und strategische Lösungen in ausländischen Rechtsordnungen suchen.
Vordenker aus den weltweit führenden Anwaltskanzleien analysieren globale Rechtsfragen und ihre wirtschaftlichen Auswirkungen. Die Law Reviews sind ein unverzichtbares Informationsinstrument für Rechtsanwälte, Unternehmensjuristen, Regierungen und Unternehmensverantwortliche.
Die Redakteure von The Law Reviews sind international anerkannte Branchenexperten in den wichtigsten Praxisbereichen.

Aktuelle News.
Managing IP Stars zeichnet Dr. Benjamin Pesch in seiner jüngsten Ausgabe erneut als „Rising Star 2023“ aus
Managing IP hat jüngst seine Rising Star Rankings 2023 veröffentlicht. Wir freuen uns sehr, dass Dr. Benjamin Pesch, Counsel, auch in diesem Jahr und bereits zum dritten Mal in Folge als Rising Star 2023 ausgezeichnet wurde.
Ganz besonders möchten wir uns bei unseren Fachkollegen und unseren Mandanten bedanken, die mit ihren Bewertungen zu diesem Ranking beigetragen haben. Das erhaltene Feedback ist der Grundstein für die Ernennung zum Rising Star. Dies ist eine Bestätigung für das professionelles Engagement von Dr. Benjamin Pesch, mit dem er den sich ständig weiterentwickelnden Bedürfnissen seiner Mandanten in hohem Maße gerecht wird.
Über Managing IP Stars:
Managing IP brachte 2018 seine erste Veröffentlichung der „Rising Stars“ heraus. Diese Sonderpublikation, die vom IP STARS-Forschungsteam veröffentlicht wird, würdigt einige der besten aufstrebenden Anwälte im Bereich des geistigen Eigentums, die zum Erfolg ihrer Kanzleien und Mandanten beigetragen haben. Bei der Auswahl werden in erster Linie die Leistungen und das Fachwissen der einzelnen Anwälte berücksichtigt, aber auch ihre Aktivitäten in der Fachwelt des Gewerblichen Rechtsschutzes.
Weitere Informationen zu den MIP Rising Stars finden Sie hier.
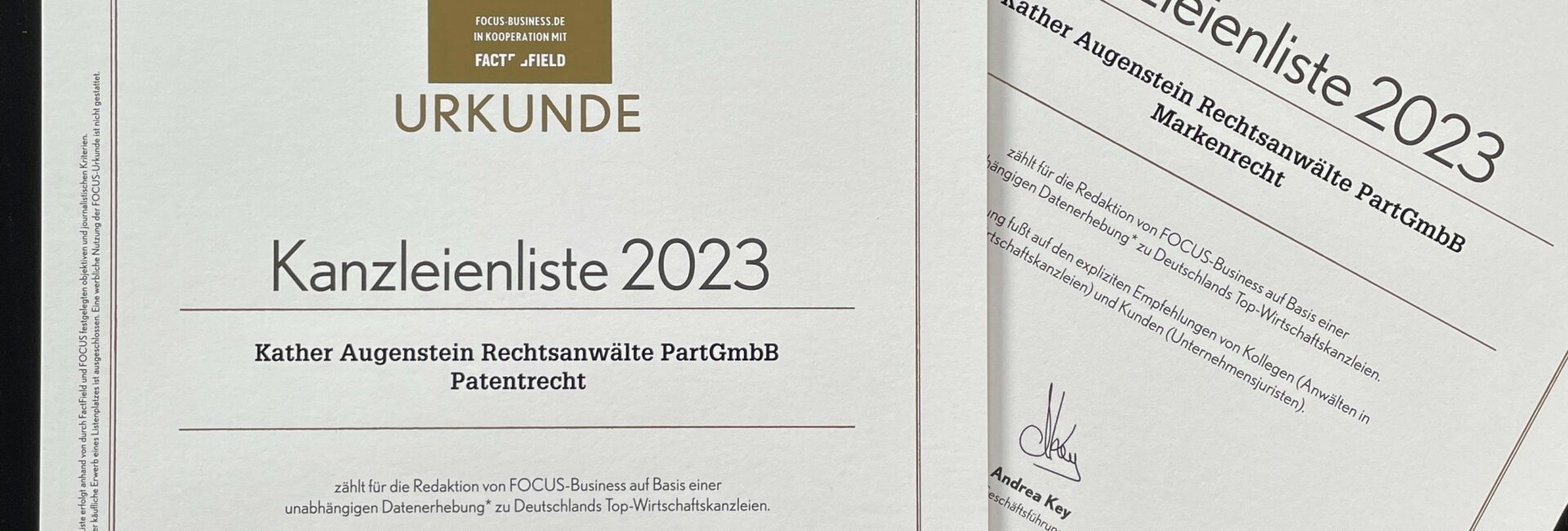
Aktuelle News.
2023 – FOCUS Recht-Spezial – Kather Augenstein erneut unter den TOP-Wirtschaftskanzleien für Patent- und Markenrecht 2023 in Deutschland
Das FOCUS-Magazin hat in seiner jüngsten Ausgabe „FOCUS-Recht-Spezial“ die gesamte Boutique Kanzlei Kather Augenstein erneut in der aktuellen Kanzleienliste 2023 als eine der TOP-Wirtschaftskanzleien 2023 in Deutschland im Bereich Patent- und Markenrecht ausgezeichnet.
Laut der Focus-Business Redaktion wurde Kather Augenstein dabei überproportional häufig von Mandantinnen und Mandanten sowie von Mitstreitern und Mitstreiterinnen empfohlen, wofür wir uns herzlich bedanken möchten.
Die vollständige Liste der empfohlenen Kanzleien für Patentrecht finden Sie hier.
Die vollständige Liste der empfohlenen Kanzleien für Markenrecht finden Sie hier.

Aktuelle News.
Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf: Kein hinreichend gesicherter Rechtsbestand des Verfügungspatents nach Widerruf des Stammpatents in einem Generikafall
OLG Düsseldorf, Urt. v. 23.02.2023 – Az. 15 W 14/21
Der 2. Zivilsenat des OLG Düsseldorf hat in seinem Urteil vom 23.02.2023 (Az. 15 W 14/21) entschieden, dass die unter Drittbeteiligung zustande gekommene Erteilung des Verfügungspatents auch in einem Generikafall keine Unterlassungsverfügung rechtfertige, sofern ihr eine Widerrufsentscheidung der Einspruchsabteilung zum inhaltsgleichen Stammpatent entgegensteht.
I. Zum Sachverhalt
Die Verfügungsklägerin ist Inhaberin des deutschen Teils eines europäischen Patents über eine pharmazeutische Zusammensetzung zur Behandlung von Multipler Sklerose. Über einen anhängigen Einspruch ist noch nicht entschieden. Das Stammpatent wurde im Rahmen eines von zehn Einsprechenden – darunter auch die Verfügungsbeklagte – geführten Einspruchsverfahren von der Einspruchsabteilung des EPA widerrufen. Die dagegen gerichtete Beschwerde wies die technische Beschwerdekammer zurück. Das widerrufene Stammpatent ist weitgehend inhaltsgleich mit dem Verfügungspatent.
Das LG Düsseldorf hat den Antrag auf Erteilung einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen, weil der Rechtsbestand nicht gesichert sei. Die Erteilung des Verfügungspatents und die Entscheidung der Beschwerdekammer stünden in einem unauflösbaren Widerspruch.
Das OLG Düsseldorf bestätigte das Urteil des LG und wies die Berufung als unbegründet zurück.
II. Zur Entscheidung
Das OLG Düsseldorf entschied, dass eine einstweilige Verfügung aufgrund eines patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs nur dann erlassen werden kann, wenn der Bestand des Verfügungspatents so eindeutig zu beantworten ist, dass eine fehlerhafte Entscheidung nicht ernstlich zu erwarten ist. Dies könne grundsätzlich nur dann sein, wenn das Verfügungspatent ein erstinstanzliches Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren überstanden hat.
Eine Ausnahme hiervon wird gemacht, wenn Sachverhalte vorliegen, in denen der Patentinhaber besonders schutzwürdig ist. Dies ist in der Regel der Fall. Denn während der von einer nicht erlassenen einstweiligen Verfügung angerichtete Schaden im Falle einer späteren Aufrechterhaltung des Patents vielfach enorm und vielfach nicht wiedergutzumachen ist, hat eine Unterlassungsverfügung, die sich nachträglich als unberechtigt erweist, nur zur Folge, dass das beklagte Generikaunternehmen vorübergehend zu Unrecht vom Markt ferngehalten wurde. Hier falle die Interessenabwägung klar zum Vorteil des Patentinhabers aus, da das beklagte Generikaunternehmen für seine Marktpräsenz regelmäßig keine eigenen wirtschaftlichen Risiken eingehen müsse.
Das OLG Düsseldorf gestand zwar zu, dass es sich hier um einen solchen Generika-Fall handle und somit grundsätzlich auch eine Verfügung zu erlassen sei, wenn keine endgültige Sicherheit über den Rechtsbestand bestünde. Allerdings stehe hier die negative streitige Rechtsbestandsentscheidung der Annahme eines gesicherten Rechtsbestands entgegen. Dies gelte auch bezogen auf ein Stamm- oder Parallelpatent, wenn sich – wie hier – die Argumente zur Schutzrechtsvernichtung auf das Verfügungspatent übertragen lassen. Der Erlass der einstweiligen Verfügung stehe der Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA entgegen, welche im Vergleich zur Prüfungsabteilung den höherrangigen Spruchkörper darstelle und technisch fachkundig sei.
Aufgrund der gegebenen Umstände war eine Auseinandersetzung mit der EuGH-Entscheidung vom 28.04.2022, Rs. C-44/21 – Phoenix / Harting, wonach eine einschränkende Rechtsprechung, dass eine einstweilige Verfügung nur nach einem erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren erlassen werden könnte, gegen Art. 9 Abs. 1 lit. a RL 2004/48 verstoße, nicht notwendig.

Aktuelle News.
Landgericht München: Konkretisierung der Anforderungen an die wechselseitige Lizenzwilligkeit von Patentinhaber und Patentbenutzer
Mit Urteil vom 17.02.2023 hat das Landgericht München I in einem Rechtsstreit zwischen GE Video Compression LLC und TCL Deutschland GmbH & Co.KG seine FRAND-Rechtsprechung konkretisiert (Az. 21 O 4140/21).
In dem Rechtsstreit vor dem Landgericht München I machte die GE Video Compression LLC Ansprüche aus einem HEVC-SEP geltend. Das Landgericht München konkretisierte in diesem Urteil seine Anforderungen an die wechselseitige Lizenzwilligkeit von Patentinhaber und Patentbenutzer bei den FRAND-Verhandlungen und wies den FRAND-Einwand von TCL mangels Lizenzwilligkeit zurück.
Das Landgericht München I legte seiner Entscheidung die Grundsätze der BGH-Entscheidungen FRAND-Einwand I und FRAND-Einwand II zugrunde. Der Patentbenutzer müsse fortdauernd den Abschluss eines FRAND-Lizenzvertrages verlangen und bereit sein am Zustandekommen dieses Vertrages mitzuwirken. Ohne diese Bereitschaft laufe der FRAND-Einwand des Patentbenutzers ins Leere. Auch der Patentinhaber müsse in den Verhandlungen lizenzwillig sein. Dabei bedingen sich das Verhalten von Patentbenutzer und Patentinhaber wechselseitig. Maßstab der Prüfung sei dasjenige, was eine vernünftige Partei, die an dem erfolgreichen und dem beiderseits interessengerechten Abschluss der Verhandlungen interessiert sei, zur Förderung dieses Ziels in einem bestimmten Verhandlungsstadium jeweils tun würde. Die Verhandlungsschritte der Parteien bauten dabei aufeinander auf. Fehle es an der Lizenzwilligkeit des Patentbenutzers, könne offengelassen werden, ob das Angebot des Patentinhabers (inhaltlich) FRAND-Bedingungen entspricht. Der Lizenzsucher müsse nur dann nicht auf ein Angebot des Patentinhabers reagieren, wenn es so FRAND-widrig ist, dass es bei objektiver Wertung schlechterdings untragbar sei.
Auf dieser Basis lehnte das Landgericht den FRAND-Einwand der Beklagten ab.
Das Landgericht prüfte dabei zunächst, ob das Angebot der Klägerseite so FRAND-widrig sei, dass es schlechterdings untragbar sei und verneinte dies. Dabei prüfte das Landgericht die Lizenzwilligkeit des Patentinhabers. Diese bestehe in der Regel nicht, wenn der Patentinhaber auf diskriminierenden oder willkürlichen Bedingungen bestehe und selbst am Ende der Verhandlungen nicht bereit sei, von diesen Bedingungen abzurücken. Soweit ein Patent-Pool für ein SEP ein Lizenzangebot abgebe, müsse sich der Patentinhaber dieses Angebot zurechnen lassen. Die Umstände dafür, dass das Angebot schlechterdings FRAND-widrig sei, müsse der Patentbenutzer darlegen und beweisen. Er müsse jedenfalls plausible Anhaltspunkte dafür vortragen, dass und warum ein Angebot diskriminierend sei. Im Einzelfall könne der Patentinhaber wegen seiner sekundären Darlegungslast gehalten sein, ergänzend zu den Angeboten vorzutragen.
Auf dieser Basis erkannte das Landgericht keine konkreten Anhaltspunkte für eine fehlende Lizenzwilligkeit der Klägerin.
In seinem Urteil begründete das Landgericht unter anderem, dass die Klägerin nicht zu Vergleichslizenzverträgen vortragen müsse, wenn der Patentbenutzer die Diskriminierung auf Basis der „effektiven Lizenzbelastung“ begründet habe. Entscheidend dafür, dass keine Diskriminierung vorliege, sei zudem, dass eine Diskriminierung jedenfalls dann entfalle, wenn die Beklagten einen Lizenzvertrag zu den Bedingungen abschließen, die die Klägerin auch der Konkurrenz eingeräumt habe. Auf diesen Vorschlag seien die Beklagten aber nicht hinreichend eingegangen. Dazu wäre ein williger Lizenznehmer aber verpflichtet gewesen.
Das Landgericht zeigte zudem auf, dass sich aus den Vergleichslizenzverträgen auch deswegen keine Diskriminierung ergeben könne, weil diese „pre-litigation“ abgeschlossen worden seien. Solche Verträge seien von Lizenzverträgen zu unterscheiden, die erst nach Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens zustande kommen.
Das Landgericht erkannte allerdings die Lizenzunwilligkeit der Beklagten. Es begründete, dass sich die fehlende Lizenzwilligkeit insbesondere aus dem zögerlichen Verhandeln ergebe. Es differenzierte dabei zwischen dem Verhalten vor Klageerhebung und dem Verhalten nach Klageerhebung.
In der Zeit bis zur Klageerhebung seien die Beklagten lizenzunwillig gewesen, da sie nicht hinreichend auf Kontaktaufnahmen des Pools reagiert hätten.
Auch nach Klageerhebung hätten sie die Lizenzverhandlungen nicht im erforderlichen Maß gefördert und die Versäumnisse der zuvor vergangenen fünf Jahre nicht ausgeglichen. Dies widerspräche der erklärten Lizenzbereitschaft.
Das Gesamtverhalten der Beklagten zeige ihr fehlendes Interesse daran, mit dem Pool und der Klägerin zügig zum Abschluss des Lizenzvertrags zu gelangen. Insbesondere hätten die Beklagten Beanstandungen an den Angeboten der Klägerin und Gründe gegen die Erfüllung von FRAND-Bedingungen nicht rechtzeitig dargelegt. Die Beklagten verfolgten das Ziel, ihre eigenen (finanziellen) Lizenzbedingungen gegen die Klägerin durchzusetzen und wendeten eine Verzögerungstaktik an. Das ergebe sich durch das stetige Anfordern weiterer Informationen, ohne dass die hierauf erteilten Auskünfte konstruktiv genutzt würden. Auch nach Klageerhebung zeige das Verhalten der Beklagten nicht, dass es ihnen um einen zügigen und angemessenen Abschluss des Lizenzvertrages gegangen sei, sondern dass die Lizenzunwilligkeit fortbestanden habe. Die Beklagten hätten an den Lizenzverhandlungen zu spät und zu wenig mitgewirkt, um die vorherigen Verzögerungen und Versäumnisse zu kompensieren. Die Gegenangebote der Beklagten zeigten, dass es ihnen nicht auf den Abschluss eines Vertrages zu FRAND-Bedingungen angekommen sei. Sie hätten Konditionen verlangt, die strukturell und juristisch für den Pool unmöglich seien, da der Pool anderenfalls gegen seine Satzung verstoße. Die Gegenangebote zielten auf einen Inhalt ab, der vom Pool nicht akzeptiert werden könne und den die Beklagten nicht beanspruchen können. Ein vernünftiger Lizenzsucher hätte nicht so lange und nachdrücklich versucht diese Konditionen durchzusetzen. Die Beklagten hätten dem Pool zudem Informationen über ihre Verkaufszahlen mitteilen müssen. Zudem zeige die verzögerte Reaktion der Beklagten – u.a. beim Gegenangebot – dass sie nicht lizenzwillig gewesen seien.
Zudem habe die Klägerin den Beklagten ein bilaterales Angebot als Alternative zur Poollösung unterbreitet. Darauf hätten die Beklagten nicht reagiert.
Das Landgericht München begründete in seiner Entscheidung zudem, dass der Einwand, die Klägerin beziehungsweise der Pool hätte gegen ihre Förderungspflicht verstoßen, nicht durchgreife. Es genüge, dass die Klägerin beziehungsweise der Pool in einem Datenraum Lizenzverträge zur Verfügung gestellt und diese laufend aktualisiert und ergänzt habe. Diese Verträge gäben den Beklagten einen ersten Eindruck von der Lizenzsituation. Ein williger Lizenznehmer würde auf dieser Basis erste Interessen und Eckpunkte eines Lizenzvertrages formulieren und möglicherweise weitere Informationen über die Bedingungen seiner wichtigsten Konkurrenten anfordern. Jedenfalls würde ein williger Lizenznehmer nicht die Vorlage sämtlicher Patente und sämtlicher Lizenzverträge fordern, ohne sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen.
Das Landgericht begründete zudem, dass der Umgang der Beklagten mit den vorgenommenen Schwärzungen die Lizenzunwilligkeit belege. Die Schwärzungen seien einerseits nicht unangemessen gewesen, da die gestellten Passagen schon nach dem Vortrag der Beklagten, keine für die Bemessung der Lizenzgebühr relevanten Informationen enthielten. Zudem hätten die Beklagten zu lange gewartet, bevor sie einen Vorlageantrag gestellt hätten.
Auch belege das stetige Anfordern weiterer Informationen die fehlende Lizenzwilligkeit. Die Beklagten hätten sich mit den zur Verfügung gestellten Informationen auseinandersetzen und die Informationen hätten sich in neuen Verhandlungspositionen widerspiegeln müssen. Dem seien die Beklagten nicht nachgekommen. Daraus ergebe sich, dass das Aufklärungsinteresse der Beklagten nur vorgeschoben gewesen sei.
Auch weitere Einwände der Beklagten änderten daran nichts, da diese Einwände zu spät vorgebracht worden seien.
Schließlich entschied das Landgericht München, dass die Vorlageanträge der Beklagten unbegründet seien. Da die Beklagten Lizenzunwillig seien, sei es nicht erforderlich, dass die Klägerin weitere Informationen offenbare und entsprechende Dokumente vorlege. Die Vorlage sei nicht entscheidungserheblich. Es sei nicht ersichtlich, dass die Beklagten infolge der Vorlage ihr verzögerndes Verhalten aufgeben würden. Es bestehe zudem kein kartellrechtlicher Vorlageanspruch. Die Beklagten hätten grundsätzlich nur einen Anspruch auf Vorlage solcher Verträge, die den gleichen Markt beträfen. Sie hätten nicht dargelegt, welche Verträge sie über die bereits vorgelegten Verträge hinaus benötigen.

Aktuelle News.
IAM Patent 1000 Ranking – Kather Augenstein unter den weltweit führenden Patentexperten 2023
Wir freuen uns sehr, dass Kather Augenstein in der aktuellen Ausgabe 2023 erneut von IAM Patent 1000 The World’s Leading Patent Professionals zu einer der weltweit führenden Anwaltskanzleien im Bereich Patentverletzung (Infringement) gewählt worden ist.
Das IAM Patent 1000 Ranking stellt Kanzleien und Einzelpersonen in den Mittelpunkt, die im zentralen Bereich des Patentrechts als herausragend gelten. Wie bei den vorherigen Ausgaben hat IAM auch für die Rangliste 2023 wieder eine umfassende qualitative Untersuchung durchgeführt, um die Top-Kanzleien und Einzelpersonen auf der Grundlage ihrer umfassenden Fachkenntnisse, ihrer Marktpräsenz und der Komplexität ihrer Arbeit zu ermitteln.
Wir freuen uns sehr, dass unsere IP Boutique mit nicht weniger als fünf ausgewiesenen Experten für Patentverletzungsverfahren im aktuellen Top-Ranking vertreten ist. Herzlichen Glückwunsch an Dr. Peter Kather, Dr. Christof Augenstein, Miriam Kiefer LL.M, Christopher Weber und Sören Dahm.

Ein besonderer Dank gilt unserem Team für die hervorragende Arbeit und unseren Mandanten für ihr anhaltendes Vertrauen in uns.
„Nach den diesjährigen Nominierungen durch IP Stars, den Top-Platzierungen von The Legal500 und Best Lawyers vom Handelsblatt ist dies eine weitere Auszeichnung in 2023, über die wir uns mit dem gesamten Team sehr freuen“, ergänzt Miriam Kiefer, Managing Partner, Kather Augenstein.
Die vollständige Online-Ausgabe 2023 finden Sie hier.

Aktuelle News.
Patentvindikation und Urkundenvorlage
Der BGH hat sich in seinem Urteil vom 26.07.2022 – X ZR 17/21 – Brustimplantat mit der patentrechtlichen Vindikation beschäftigt und dabei seine etablierte Rechtsprechung gefestigt:
Ob ein Berechtigter nach § 8 S. 1 und 2 PatG die Übertragung eines Patents oder die Einräumung einer Mitberechtigung daran verlangen kann, erfordert einen prüfenden Vergleich der zum Patent angemeldeten Lehre mit derjenigen, deren widerrechtliche Entnahme geltend gemacht wird. Dafür ist in erster Linie zu untersuchen, inwieweit beide Lehren übereinstimmen (Bestätigung von BGH GRUR 2016, 265, Rn. 22 – Kfz Stahlbauteil; BGH GRUR 2020, 1186, Rn. 41 – Mitralklappenprothese). Ferner zeigt das Urteil einen schönen Überblick über die Möglichkeiten eine nicht beweisbelastete Partei zur Urkundenvorlage bei Gericht zu verpflichten.
Sachverhalt:
In dem zugrundeliegenden Sachverhalt hatten zwei Unternehmen über mehr als ein Jahrzehnt hinsichtlich der Entwicklung von Brustimplantaten zusammengearbeitet. Dabei war es vermehrt zu Werksbesichtigungen und Unternehmensbesuchen gekommen, deren Ausmaß zwischen den Parteien streitig war. Nach dem Ende der Zusammenarbeit meldete die Beklagte das streitgegenständliche Patent an.
Das Streitpatent offenbart ein Verfahren zur Herstellung von Implantaten oder Zwischenprodukten solcher Implantate. Hierbei soll eine umförmige Naht auf der Implantathülle vermieden werden, da es hierdurch zu Körperunverträglichkeiten kommen kann. Hierzu wird diese auf der Rückseite der Implantathülle gebildet, indem eine erste Schaumlage bis hin zur Rückseite auf dem Silikon angeordnet wird. Die Schaumlage wird durch Vulkanisierung mit der Implantathülle verbunden. Die zweite Schaumlage muss daraufhin nur noch einen kleinen Bereich auf der Rückseite der Implantathülle abdecken, was den Umfang der Naht deutlich verringert.
Die Klägerin hatte im Verfahren verschiedene Dokumente vorgelegt, aus denen sich ergeben sollte, dass sie bereits im Besitz der patentgemäßen Lehre gewesen war. Die Klägerin beantragte unter anderem, die Beklagte zu verurteilen, sämtliche nationalen Teile des Patents auf die Klägerin zu übertragen und in die Umschreibung der nationalen Teile gegenüber den jeweiligen nationalen Patentämtern einzuwilligen, hilfsweise die Einräumung einer Mitberechtigung.
Die Beklagte trug vor, dass es sich bei dem Patent um das Ergebnis eigener Forschung handele. Dies sollte sich insbesondere aus einem Dokument (TD 2007) ergeben, welches zum Ende der Zusammenarbeit von der Beklagten erstellt wurde. Die Klägerin wandte hiergegen ein, dass dieses Dokument inhaltlich nahezu identisch mit einem älteren Dokument (TD 2003) sei, das aus der Zusammenarbeitszeit der Parteien herrührte. Unterschiede ergäben sich nur bezüglich eines anderen Produktionsstandortes. Allerdings war das TD 2003 ausschließlich im Besitz der Beklagten.
Das LG Frankfurt a. M. und das OLG Frankfurt a. M. hatten die Klage abgewiesen, da die Klägerin weder Erfindungsbesitz noch Entnahmehandlung ausreichend belegt habe.
DArlegung der Vindikationsvoraussetzungen:
Der BGH hob das Urteil auf und verwies es zur erneuten Verhandlung zurück an das OLG Frankfurt a. M. Nach Ansicht des BGH hatte die Klägerin den Erfindungsbesitz durch die Dokumentenvorlage hinreichend vorgetragen. Der BGH sah als Lehre des Patents nicht nur Vulkanisieren als Aufbringungsform erfasst, sondern es ergäbe sich aus der Beschreibung ebenfalls, dass die Schaumlage vor dem Vulkanisieren gezogen, gedrückt oder gestreckt werde. Vor diesem Hintergrund habe die Klägerin bereits ausreichend ihren Erfindungsbesitz vorgetragen. Denn ein Sachvortrag zur Begründung eines Anspruchs ist schlüssig und erheblich, wenn die Partei Tatsachen vorträgt, die in Verbindung mit einem Rechtssatz geeignet und erforderlich sind, das geltend gemachte Recht als in der Person der Partei entstanden erscheinen zu lassen. Der Vortrag muss konkret genug sein, um die Erheblichkeit der Tatsachen beurteilen zu können und eine Stellungnahme des Gegners zu ermöglichen. Sind diese Anforderungen erfüllt und wird der Vortrag von der Gegenseite erheblich bestritten, ist es Sache des Tatrichters, in die Beweisaufnahme einzutreten (beispielhaft: BGH NJW-RR 2022, 634, Rn. 10).
Aus den Unterlagen der Klägerin habe sich insoweit ergeben, dass sie bereits zu einem früheren Stadium der Zusammenarbeit Brustimplantate nach einem Verfahren herstellte, welches die Merkmale des Streitpatents aufwies.
Soweit sich die Beklagte auf das Dokument TD 2007 stützte, hielt es der BGH für möglich, dass sich aus einem Abgleich mit der TD 2003 ergeben könne, dass bereits die TD 2003 die Erfindung vollständig beschrieb.
Urkundenvorlagepflichten:
Im Folgenden setzte sich der BGH daher mit der Frage auseinander, ob die Beklage hier eine Urkundenvorlagepflicht treffe. Eine solche Pflicht hat der BGH aus § 423 ZPO in Übereinstimmung mit dem OLG Frankfurt a. M. abgelehnt, da die Beklagte allenfalls zur Erläuterung ihres Vorbringens auf die Urkunde Bezug nahm und nicht wie der Wortlaut verlangt „zur Beweisführung“.
Der BGH rügte jedoch das vorzeitige Ablehnen einer Pflicht nach § 422 ZPO iVm. § 810 ZPO, da die TD 2003 noch während der intensiven Zusammenarbeit erstellt wurde und daher zumindest auch im Interesse der Klägerin erstellt worden war. Bei seiner erneuten Entscheidung müsse das OLG Frankfurt a. M. auch etwaige Geheimhaltungsinteressen mit der Wahrscheinlichkeit abwägen, ob die TD 2003 bereits die Erfindung vollständig beschreibe.
Sollte sich keine Pflicht aus § 422 ZPO ergeben, müsse das Berufungsgericht erneut über die Vorlegeanordnung nach § 142 Abs. 1 ZPO entscheiden. Eine Ablehnung sei jedenfalls nicht allein auf Geheimhaltungsinteressen der Beklagten zu stützen, da diesen auch durch Schwärzen der nicht relevanten Passagen Rechnung getragen werden könne. Der BGH verweist zudem pauschal auf die Möglichkeit einer Schutzanordnung nach dem neuen § 145a PatG iVm §§ 16, 19 GeschGehG.
Schöpferischer Beitrag:
Bei der anschließenden Beurteilung eines schöpferischen Beitrages der Klägerin sei es nicht erforderlich, dass er einen eigenständigen erfinderischen Gehalt aufweise (BGH GRUR 2001, 903, Rn. 14, 21- Atemdrucksteuerung). Ferner sei es verfehlt, jedes Merkmal zu untersuchen, ob es für sich genommen, im Stand er Technik bekannt sei (BGH GRUR 2001, 903, Rn., 21- Atemdrucksteuerung). Auszuscheiden haben nur solche Beiträge, die den Gesamterfolg nicht beeinflusst haben, also unwesentlich in Bezug auf die Lösung sind, ferner solche, die auf Weisung eines Erfinders oder Dritten geschaffen wurden (BGH GRUR 2020, 1186, Rn. 39 – Mitralklappenprothese).
FAZIT:
Zusammenfassend stellt das Urteil kein rechtliches Novum dar. Es unterstreicht nochmals, dass auch und gerade bei der Vindikation die Lehre des angemeldeten Patents im Vordergrund stehen muss. In Vindikationsfällen ist ferner der Kläger zunächst in der Regel im Hintertreffen. Sein Vortrag muss konkret genug sein, um die Erheblichkeit der Tatsachen beurteilen zu können und eine Stellungnahme des Gegners zu ermöglichen, aber eben auch nicht mehr. Hierfür empfiehlt sich bei der Darlegung nach Möglichkeit auf Dokumente zurückzugreifen und weniger mit Zeugen zu arbeiten, die etwa Unternehmensbesuche und deren Ausmaße belegen sollen.
Darüber hinaus zeigt das Urteil verschiedene prozessuale Möglichkeiten auf, wie die nicht beweisbelastete Partei zur Urkundenvorlage verpflichtet werden kann. Der BGH hat insofern bereits in NJW 2007, 2989 – Einwertungsunterlagen für „Schrottimmobilien“ klargestellt, dass es einen Ermessensfehler darstellt, wenn das Gericht bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 142 ZPO eine Anordnung überhaupt nicht in Betracht zieht. Gerade Praktiker sollten die einschlägigen Vorschriften damit im Hinterkopf behalten.

Aktuelle News.
Vertiefte Spezialisierung im Gewerblichen Rechtsschutz – Sophie Prudent und Dr. Benedikt Walesch erwerben Master of Laws (LL.M.)
Unsere Kollegin Sophie Prudent und unser Kollege Dr. Benedikt Walesch haben erfolgreich am berufsbegleitenden Masterstudiengang im Gewerblichen Rechtsschutz an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf teilgenommen. Ihre mit exzellenten Noten erlangten Abschlüsse feierten sie am vergangenen Freitag, den 24. Juni 2023, auf Schloss Mickeln.
Das Studium ist besonders praxisorientiert ausgerichtet. „Es war sehr bereichernd, dass wir uns in den Vorlesungen von erfahrenen Praktikerinnen und Praktikern hilfreiche Kniffe abschauen und unser Wissen im Gewerblichen Rechtsschutz vertiefen konnten. Wir haben uns bewusst für den berufsbegleitenden Studiengang an der Heinrich-Heine-Universität entschiedenen, um für unsere Mandantinnen und Mandanten immer ansprechbar zu bleiben und das Gelernte direkt in der Praxis umsetzen zu können. Bei der umfangreichen Weiterbildung setzt das natürlich ein sehr gutes Zeitmanagement voraus“, berichten Sophie Prudent und Benedikt Walesch übereinstimmend. „Wir können jedem, der seine Fachkenntnis im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutz vertiefen will, dieses Studium sehr empfehlen“.
Sophie Prudent legte mit Ihrer Masterarbeit einen Schwerpunkt auf nationale einstweilige Verfügungsverfahren im Patentrecht. „Die deutsche Rechtsprechung wird seit jeher kontrovers diskutiert. Die EuGH-Entscheidung Phoenix Contact/Harting ist ebenfalls auf Kritik gestoßen. Ich fand es spannend mich mit den unterschiedlichen Begründungsansätzen und den möglichen Auswirkungen des EuGH-Urteils auf die Rechtsprechung auseinanderzusetzen“, sagt Sophie Prudent. Ihre Arbeit wurde mit der Bestnote „hervorragend“ bewertet.
Dr. Benedikt Walesch vertiefte sich in seiner Masterarbeit mit dem UPC-Gerichtssystem und beschäftigte sich mit den „Einstweiligen Maßnahmen vor dem UPC“ und verglich diese mit den nationalen Verfahrensregeln. „Ich finde es spannend an vorderster Front bei der Entstehung eines neuen Gerichtssystems mitzuwirken. Deswegen wollte ich mich in meiner Masterarbeit vertieft mit Regelungen des neuen Systems auseinandersetzen und die neuen Regelungsansätze mit dem nationalen Recht vergleichen.“ Für seine Masterarbeit erhielt er ebenfalls die Bestnote „hervorragend“.
Es freut uns ganz besonders, dass unser Kollege Dr. Benedikt Walesch den Masterstudiengang als Jahrgangsbester insgesamt mit der Bestnote „hervorragend abschließen konnte. Für diese herausragende Leistung wurde ihm der Preis für den besten Abschluss verliehen. Zu diesen tollen Leistungen gratulieren wir unseren Kollegen Sophie Prudent und unserem Kollegen Dr. Benedikt Walesch ganz herzlich. Sie führen den international anerkannten und renommierten Studienabschluss des „Master of Laws“ (LL.M.).
Liebe Sophie, lieber Benedikt: Herzlichen Glückwunsch!
