
Aktuelle News.
Zuständigkeit der europäischen Gerichte bei grenzüberschreitenden Patentverletzungen – EuGH BSH v Electrolux
Eine weitere Grundsatzentscheidung des EuGH zur internationalen Zuständigkeit der Gerichte der EU-Mitgliedsstaaten sorgt dieser Tage für Furore. Am 25.02.2025 hat der EuGH seine lang erwartete Entscheidung im Fall BSH Hausgeräte vs Electrolux (C-339/22) veröffentlicht.
Vorgeschichte und Vorlagefragen
Ausgangspunkt des Vorabentscheidungsgesuchs an den EuGH ist ein Patentverletzungsverfahren in Schweden. Die BSH Hausgeräte GmbH erhob dort im Jahr 2020 eine Klage wegen Verletzung aller nationalen Bestandteile eines europäischen Patents gegen die Electrolux AB. Das Klagepatent wurde in Deutschland, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Österreich, Schweden, im Vereinigten Königreich und in der Türkei validiert.
Elektrolux rügte die Unzulässigkeit der Anträge in Bezug auf die Verletzung der nationalen Bestandteile, mit Ausnahme des schwedischen. Kern der Rüge war der Einwand, dass die nicht-schwedischen Patente ungültig seien und dass das schwedische Gericht entsprechend nicht dafür zuständig sei, über die Verletzung zu entscheiden.
Das Gericht erklärte sich Ende 2020 für alle nicht-schwedischen Patente für unzuständig auf Grundlage von Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-VO. Gegen diese Entscheidung ist BSH in Berufung gegangen. Das Berufungsgericht hatte vor dem Hintergrund der Ausnahmeregelung in Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-VO ebenfalls Zweifel an der Zuständigkeit der schwedischen Gerichte.
Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-VO regelt eine Ausnahme von dem Grundsatz der Zuständigkeit der Gerichte des Wohnsitzstaats von Beklagten (Art. 4 Brüssel-Ia-VO). Hiernach sind für Verfahren, welche die „Gültigkeit von Patenten […] zum Gegenstand haben“ ohne Rücksicht auf den Wohnsitz, die Gerichte des Mitgliedsstaats ausschließlich zuständig, für den das europäische Patent erteilt wurde. Diese Zuständigkeit gilt nach dem weiteren Wortlaut der Regelung „unabhängig davon, ob die Frage im Wege der Klage oder der Einrede aufgeworfen wird“.
Vor diesem Hintergrund setzte das schwedische Berufungsgericht das Verfahren aus und legte dem EuGH drei Fragen zur Vorabentscheidung vor (von der Autorin zusammengefasst).
1. Verliert ein nationales Gericht, das nach Art. 4 Abs. I Brüssel-Ia-Verordnung zuständig ist, seine Zuständigkeit für die Entscheidung über die Verletzungsklage, wenn einredeweise die Ungültigkeit des Klagepatents geltend gemacht wird oder ist das Gericht lediglich für die Entscheidung über die Einrede der Ungültigkeit unzuständig?
2. Findet Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-VO auf Drittstaaten (non-EU) Anwendung?
3. Kann sich eine nationale Regelung auf die Auslegung von Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-VO auswirken?
Die Beantwortung der Fragen 1 und 2 dürfte für Patentverletzungsverfahren in der EU große Relevanz haben.
Die Entscheidung
Geltendmachung eines in einem anderen EU-Mitgliedstaat erteilten Patents
Der EuGH beschäftigt sich zunächst mit der Konstellation, in der die klagende Partei vor dem Gericht des EU-Wohnsitzes der Beklagten einen anderen nationalen Teil eines Europäischen Patents geltend macht und die Beklagte die Einrede der Nichtigkeit erhebt.
Die Zuständigkeit des Wohnsitz-Gerichts ergibt sich aus Art. 4 Abs. 1 Brüssel-Ia-VO, der die Zuständigkeit allerdings nur vorbehaltlich der weiteren Regelungen begründet.
Nach Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-VO sind die Gerichte des Mitgliedstaats der Patenterteilung ausschließlich zuständig, über einen Angriff der Gültigkeit des Patents zu entscheiden, unabhängig davon, ob eine solche Anfechtung im Wege der Klage oder im Wege der Einrede geltend gemacht wird (Kodifizierung EuGH GAT v LuK, C-4/03).
Daraus folgt bereits nach der GAT-Rechtsprechung, dass es einem Gericht, das mit einem Verfahren wegen der Verletzung eines von einem anderen Mitgliedstaat erteilten Patent befasst ist, in dessen Rahmen die Gültigkeit des Patents angegriffen wird, nicht gestattet ist, inzident die Nichtigkeit des Patents festzustellen. Es muss sich hinsichtlich der Frage der Gültigkeit des Patents für unzuständig erklären.
Darüber hinaus hatte der EuGH nun zu klären, ob das Wohnsitz-Gericht der Beklagten unter solchen Umständen zuständig bleibt, über die Patentverletzungsklage zu entscheiden, oder ob es sich insgesamt für unzuständig zu erklären hat.
Hier wird es nun interessant, denn der EuGH stellt fest, dass das Gericht des Wohnsitzes seine Zuständigkeit über die Verletzungsklage nicht verliert. Die nachfolgenden Überlegungen leuchten unmittelbar ein. Neben dem Prinzip, dass Ausnahmen von Grundsätzen eng auszulegen sind, würde bei anderer Auslegung die Ausnahme zur Regel. Denn in einem Großteil der Patentstreitigkeiten greift die Beklagte den Rechtsbestand des Klagepatents an. Dann hätte die Beklagte es nicht nur in der Hand, durch die eigene Verteidigungsstrategie die Zuständigkeit des Gerichts zu entziehen, sondern könnte auch entscheiden, wann sie dies tut. Dann müsste sich ein ordnungsgemäß befasstes Gericht aufgrund einer Handlung der Beklagten für unzuständig erklären. Dies würde mangels Verweismöglichkeit zur Beendigung des Verfahrens führen. Die Brüssel-Ia-VO soll aber gerade durch ein hohes Maß an Vorhersehbarkeit der Zuständigkeitsvorschriften Rechtssicherheit gewährleiten.
Der EuGH verweist weiter auf die Vorteile seiner Auslegung: So wird Inhaberinnen und Inhabern von EPs, deren Schutzrecht von derselben Beklagten in mehreren Mitgliedstaaten verletzt wird, ermöglicht ihre Ansprüche zu bündeln und eine umfassende Entschädigung an einem einzigen Gerichtsstand zu erhalten. Dies vermeidet auch die Gefahr einander widersprechender Entscheidungen.
Wer nun auf die Idee kommt, dass der EuGH damit Beklagten die Einrede des mangelnden Rechtsbestands als Verteidigung nimmt, muss das Urteil des EuGH weiter studieren. Denn dieser stellt explizit klar, dass die Trennung von Verletzung und Rechtsbestand nicht dazu führt, dass das Verletzungsgericht außer Acht lassen muss, wenn von der Beklagten in einem anderen Mitgliedsstaat ordnungsgemäß Klage auf Nichtigerklärung erhoben wurde. Ist das Wohnsitz-Gericht der Auffassung, dass eine vernünftige und nicht zu vernachlässigende Möglichkeit besteht, dass das Patent für nichtig erklärt wird, kann es das Verletzungsverfahren aussetzen.
Geltendmachung eines in einem Drittstaat erteilten Patents
Darüber hinaus hatte der EuGH zu klären, wie es sich mit der Zuständigkeit des Wohnsitz-Gerichts verhält, wenn die Klägerin ein in einem Drittstaat erteiltes Patent geltend macht.
Zunächst stellt der EuGH hierzu fest, dass es sich bei der Brüssel-Ia-VO um interne Zuständigkeitsregelungen der EU handelt. Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-VO kann somit keine Anwendung finden und einem Gericht eines Drittstaats somit keine Zuständigkeit zuweisen.
Mangels Sonderbestimmungen bliebe die Zuständigkeit über die Einrede der Nichtigkeit zu entscheiden nach Art. 4 I Brüssel-Ia-VO beim Wohnsitz-Gericht. Eine Art. 24 Nr. 4 Brüssel-Ia-VO entsprechende Sondervorschrift enthält z.B. das Lugano-Abkommen (Norwegen, Island, Schweiz). Mit weiteren Drittstaaten können bilaterale Übereinkünfte eine Rolle spielen. Liegen solche nicht vor, wie bei der Türkei, sind noch Art. 33 und Art. 34 Brüssel-Ia-VO zu beachten.
Im Übrigen verbleibt die Zuständigkeit über die Nichtigkeitseinrede zu befinden nach der Entscheidung des EuGH bei dem angerufenen Wohnsitz-Gericht. Nach den Feststellungen des EuGH verstößt dies insbesondere nicht gegen den Grundsatz der Nichteinmischung des Völkerrechts (ein Staat darf sich nicht in Angelegenheiten einmischen, die im Wesentlichen in die nationale Zuständigkeit eines anderen Staats fallen). Denn die Entscheidung über den Rechtsbestand im Rahmen einer Einrede im Verletzungsverfahren hat formell keinerlei Auswirkungen auf das tatsächliche Bestehen oder den Inhalt des Patents in dem Drittstaat. Eine solche Entscheidung hat nach den Ausführungen des EuGH ausschließlich Wirkungen inter partes, denn die Einrede zielt lediglich darauf ab die Abweisung der Klage und nicht die Nichtigerklärung des Patents zu erreichen.
Praktische Auswirkungen
So verlockend es klingen mag, die einfache Bündelung aller Verletzungsansprüche vor einem Gericht auszurufen, steckt der Teufel doch im Detail.
Zunächst bedarf es einer tauglichen Beklagten, die ihren Sitz in dem passenden EU-Mitgliedstaat hat. Dieser Beklagten können nun alle Verletzungshandlungen innerhalb und außerhalb der EU vorgeworfen werden. Es müssen allerdings Verletzungshandlungen dieser Beklagten sein. Hier kommt es bereits im Detail auf die Konzernstruktur und den Aufbau der Vertriebskette an.
Ist eine solche Beklagte gefunden, kann das Wohnsitz-Gericht wegen der Patentverletzungen in mehreren Ländern angerufen werden. Ob ein solches Vorgehen auf Klägerseite von Erfolg gekrönt sein wird, hängt von der eigenen Vorbereitung und der Reaktion der Beklagten ab. Neben der Darlegung der Verletzungshandlungen richtet sich die Beurteilung der Verletzung und des Rechtsbestands nach dem Recht des Staats für den Schutz beansprucht ist (Art. 8 I Rom II-VO). Die Klägerin muss also die Verletzung nach dem Recht des Erteilungsstaates vortragen und gegebenenfalls Beweis hierzu erbringen.
Klägerinnen, die von der neuen Rechtsprechung des EuGH also Gebrauch machen wollen, müssen einige Hürden nehmen, die mit mehr oder weniger Aufwand verbunden sein können. Es gilt weiterhin sehr genau zu prüfen, ob der zu erwartende Aufwand und die möglicherweise zu erwartenden Verzögerungen im Verletzungsverfahren, dem Interesse und den wirtschaftlichen Erwartungen an ein Verletzungsverfahren entsprechen.
Und diese Grundsätze sind nunmehr auf das UPC zu übertragen. Das EPGÜ gilt nach Art. 3 EPGÜ für alle EP mit einheitlicher Wirkung und alle EP für die kein Opt-out erklärt wurde. Die Reichweite dieser Schutzrechte ist insoweit auf die Vertragsmitgliedsstaaten des EPÜ begrenzt. Diese sind wiederum in EU und nicht-EU Staaten zu unterteilen. Das Gericht wird dann wie oben beschrieben vorgehen. Insoweit hat die Lokalkammer Düsseldorf die Entscheidung des EuGH in seiner Entscheidung Fujifilm vs Kodak (Urt. 28.01.2025, CFI_355/2923) bereits antizipiert und sich richtigerweise für zuständig erklärt über den UK-Teil eines EP zu entscheiden. Hier kam es aufgrund von Zweifeln am Rechtsbestand letztlich aber nicht mehr auf die Verletzung an (mehr hierzu im Blogartikel meines Kollegen Carsten Plaga).
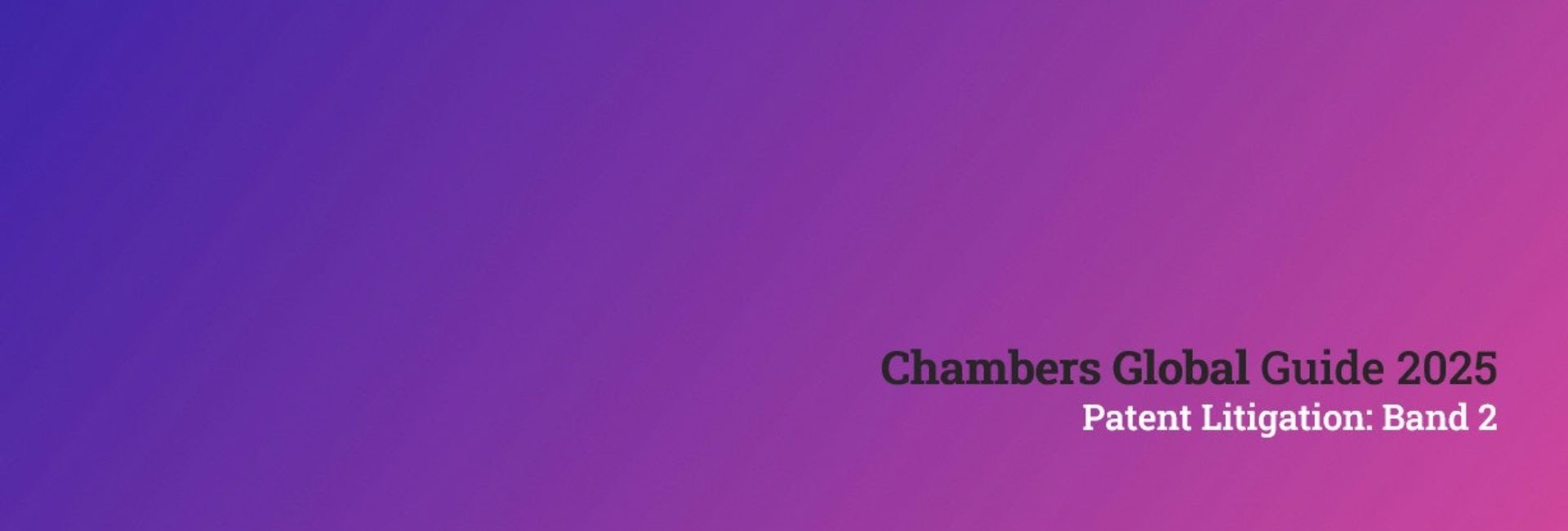
Aktuelle News.
Chambers Ranking Patent Litigation – Kather Augenstein in Chambers Global 2025 erneut ausgezeichnet
Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Kather Augenstein in den aktuellen Chambers Global 2025 Rankings im Bereich Patent Litigation in Band 2 eingestuft wurde.
Chambers hebt besonders hervor:
Kather Augenstein ist auf komplexe Verletzungsfälle spezialisiert und vertritt Mandanten aus den Bereichen Technologie, Biowissenschaften und Telekommunikation. Die IP-Boutique ist in Nichtigkeitsklagen, Verletzungsverfahren und internationalen Rechtsstreitigkeiten tätig und bietet umfassende Beratung zu FRAND-Lizenzierung, vertrieblichen Fragen und Unterlassungsklagen. Besonders geschätzt wird die grenzüberschreitende Expertise der Kanzlei, insbesondere von Mandanten aus den USA und Japan.
Zu unseren Stärken:
- „Kather Augenstein ist eine äußerst vertrauenswürdige Kanzlei mit fundiertem Wissen über das neue UPC-System.“
- „Das Team leistet ausgezeichnete Arbeit und zeigt stets vollen Einsatz – unabhängig von der Größe des Mandanten.“
- „Die Anwälte sind aufgeschlossen, zuvorkommend und hochkompetent.“
- „Sie liefern zuverlässige, schnelle Lösungen und entwickeln effektive Strategien zur erfolgreichen Fallbearbeitung.“
- „Die Fachleute bei Kather Augenstein sind erfahren, hochmotiviert und arbeiten mit außergewöhnlicher Gründlichkeit – die Zusammenarbeit ist stets angenehm.“
Diese Anerkennung unterstreicht einmal mehr unser Engagement für Exzellenz und Mandantenzufriedenheit. Wir danken unseren Mandanten für ihr Vertrauen und unserem Team für seine herausragende Arbeit!
Wir freuen uns außerdem über die individuellen Rankings drei unserer Partner:
- Dr. Peter Kather – Senior Statespeople
- Dr. Christof Augenstein – Band 2
- Miriam Kiefer LL.M. – Band 4

Aktuelle News.
“Long arm jurisdiction” vor dem UPC: Lokalkammer Düsseldorf bejaht Zuständigkeit für britischen Teil eines Europäischen Patents
Lokalkammer Düsseldorf, Entscheidung vom 28.01.2025, Fujifilm v Kodak (UPC_CFI_355/2023)
Am 28.01.2025 entschied die Lokalkammer Düsseldorf des Einheitlichen Patentgerichts (UPC) in der Sache UPC_CFI_355/2023 über die Zuständigkeit für eine Klage bezüglich des britischen Teils eines europäischen Patents. Diese Entscheidung wirft wesentliche Fragen zur internationalen Zuständigkeit des UPC und deren Reichweite im Hinblick auf Nicht-UPC-Mitgliedstaaten wie das Vereinigte Königreich auf.
I. Sachverhalt
In der zugrunde liegenden Klage machte die Klägerin eine Patentverletzung geltend und beantragte unter anderem Unterlassung sowie Schadenersatz für Handlungen in Deutschland sowie im Vereinigten Königreich. Die Beklagten erhoben eine Einrede gegen die Zuständigkeit des UPC in Bezug auf den britischen Teil des EP, insbesondere mit dem Argument, dass Art. 34 EPGÜ die Gerichtsbarkeit des UPC auf Vertragsstaaten des UPC beschränke. Zudem wurde auf die exklusive Zuständigkeit britischer Gerichte gemäß internationalen Prinzipien des Patentrechts verwiesen.
Die Beklagten erhoben eine Widerklage auf Nichtigerklärung des Klagepatents und beantragten, das Klagepatent in allen Vertragsstaaten, in denen das Klagepatent gültig ist, für nichtig zu erklären. Einen expliziten Antrag, das Klagepatent auch in dem Vereinigten Königreich für nichtig zu erklären, haben die Beklagten nicht gestellt.
II. Entscheidung und Begründung
Die Lokalkammer Düsseldorf bejahte die Zuständigkeit des UPC für den britischen Teil des Klagepatents.
Die Lokalkammer Düsseldorf sei gemäß Art. 4 EuGVVO international zuständig, weil alle Beklagten ihren Sitz in Deutschland haben. Da die Zuständigkeit auf den Sitz und nicht auf die Handlungen der Beklagten begründet sei, hat die Lokalkammer auch für Handlungen in Drittstaaten ihre internationale Zuständigkeit angenommen. Weiterhin führt die Entscheidung aus, dass Art. 71b EuGVVO die Zuständigkeit des UPC regelt und ausdrücklich Rechtsstreitigkeiten umfasst, die sich aus europäischen Patenten ergeben, auch wenn sie sich auf Nicht-Vertragsstaaten beziehen. Damit sei die Regelung territorial nicht auf die Vertragsstaaten beschränkt. Zudem enthalte Art. 34 EPGÜ keine Einschränkungen dahingehend, dass eine Entscheidung über den britischen Teil eines europäischen Patents ausgeschlossen sei. Art. 34 EPGÜ würde vielmehr nur den Fall regeln, wenn das EP nicht im gesamten Vertragsgebiet des UPC validiert sei. Damit enthalte Art. 34 EPGÜ aber keine Regelung über EPs die außerhalb des Vertragsgebiets validiert sind.
Im Ergebnis hat die Lokalkammer Düsseldorf die Klage aber auch in Bezug auf den britischen Teil des Klagepatents abgewiesen. Das Gericht ist zu dem Ergebnis gelangt, dass ein von der Klägerin vorgebrachter Nichtigkeitsgrund greife und hat aufgrund der Widerklage auf Nichtigerklärung den deutschen Teil des Klagepatents für nichtig erklärt. Vor diesem Hintergrund hat das Gericht keine Entscheidung gegen die Beklagten aus dem britischen Teil erlassen, weil die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents eine Voraussetzung für die Verurteilung der Beklagten sei. Es sei nicht ersichtlich, dass die Frage des Rechtsbestandes nach britischen Recht anders zu beurteilen sei.
Das Gericht hat offengelassen, ob sie für eine etwaige Widerklage auf Nichtigerklärung des britischen Teils des Klagepatents zuständig gewesen wäre, da die Beklagten die Widerklage auf Nichtigerklärung ohnehin nicht auf den britischen Teil ausgeweitet haben.
Die Entscheidung unterstreicht, dass durch das UPC eine einheitliche Rechtsdurchsetzung ermöglicht werden soll, was der Zielsetzung des UPCA entspricht. Dies gelte selbst dann, wenn der betroffene Patentteil in einem Nicht-UPC-Staat wie dem Vereinigten Königreich registriert ist.
III. Fazit
Die Entscheidung der Lokalkammer Düsseldorf liefert wichtige Klarstellungen zur Zuständigkeit des UPC in Fällen, die Nicht-Vertragsstaaten betreffen. Sie stärkt die Position des Einheitlichen Patentgerichts als zentralem Forum für die Durchsetzung europäischer Patente. Inhaltlich folgt die Lokalkammer Düsseldorf den von den nationalen Gerichten in Deutschland angewendeten Grundsätzen.
Zutreffend ist die Entscheidung der Lokalkammer Düsseldorf jedenfalls dahingehend, die Beklagten nicht aus dem britischen Teil zu verurteilen. Die Verletzung des britischen Teils war nach britischem Teil zu beurteilen. Nach britischem Recht stünde den Beklagten den Einwand der Nichtigkeit zu. Da das Gericht den deutschen Teil des Klagepatents für nichtig erklärt hat und keine Abweichungen nach dem britischen Recht in Bezug auf die Beurteilung der Nichtigkeit ersichtlich waren, war eine Verurteilung aus diesem Grund ausgeschlossen.
Aus strategischer Sicht kann es sich daher zukünftig je nach Einzelfall anbieten, den britischen Teil eines Europäischen Patents ebenfalls vor dem UPC geltend zu machen. Unklar ist allerdings, wie das UPC die Verletzung eines Europäischen Patents nach britischen Recht beurteilen wird und wie sich dies auf das Verfahren und insbesondere auf die Verfahrensdauer auswirken wird. Offen bleibt auch, ob andere Lokalkammern bzw. das Berufungsgericht dieser Entscheidung folgen werden.
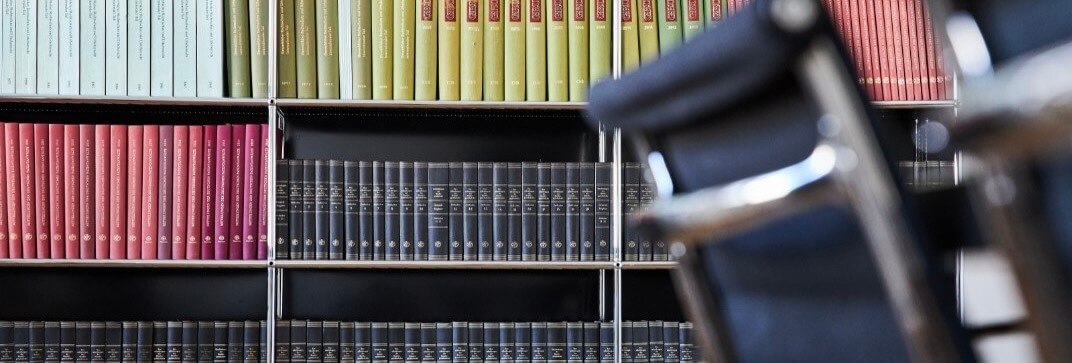
Aktuelle News.
Berufungsgericht: Zu den Voraussetzungen eines Rücktritts vom Opt-out nach Art. 83 (4) EPGÜ
Berufungsgericht des EPG, Entscheidung vom 12.11.2024, UPC_COA_489/2023 und 500/2023 – AIM Sport Development / Supponor et al.
I. Sachverhalt
Für das Klagepatent wurde am 12. Mai 2023 (während der „Sunrise Period“) ein Opt-out erklärt. Das Opt-out wurde am 01. Juni 2023 in das EPG-Register eingetragen. Am 05. Juli 2023 stellte die Klägerin einen Antrag auf Rücktritt vom Opt-Out. Am selben Tag reichte die Klägerin eine Verletzungsklage betreffend die Verletzung des Klagepatents und einen Antrag auf Erlass von einstweiligen Maßnahmen gegen die Beklagten ein. Die Lokalkammer Helsinki wies die Verletzungsklage und den Antrag auf Erlass von einstweiligen Maßnahmen mit der Begründung zurück, das EPG sei aufgrund seines Opt-out vom 12. Mai 2023 nicht zuständig. Der Rücktritt sei unwirksam, da zum Zeitpunkt des Opt-out und des Rücktritts vom Opt-out noch Klagen vor den deutschen nationalen Gerichten anhängig gewesen, die im Jahre 2020 erhoben worden seien.
II. Entscheidung des Berufungsgerichts
Das Berufungsgericht hebt die Entscheidung des Gerichts erster Instanz auf.
Der Satz „Sofern nicht bereits eine Klage bei einem nationalen Gericht erhoben wurde“ in Art. 83 Abs. 4 EPGÜ sei in Anbetracht des Wortlauts, der Struktur, des Sinns und Zwecks des Art. 83 EPGÜ in seiner Gesamtheit so zu verstehen, dass er sich auf eine Klage beziehe, die während der Übergangsregelung vor einem nationalen Gericht erhoben werde. Frühere nationale Klagen (vor Inkrafttreten der Übergangsregelung) fallen nicht unter die Einschränkungen des Rücktritts vom Opt-out.
Das Berufungsgericht hat die in Art. 31 Abs. 1 der Wiener Vertragsrechtskonvention festgelegten Auslegungsregeln bei der Auslegung des Art. 83 EPGÜ herangezogen und festgestellt, dass der Begriff „Klage“ in Art. 83 Abs. 4 EPGÜ nicht isoliert, sondern im Gesamtkontext des Art. 83 EPGÜ verstanden werden müsse. Das Gericht sieht keinen Grund, den Begriff „Klage“ in Abs. 4 anders auszulegen als den Begriff „Klage“ in Abs. 1, 2 und 3, d.h. als eine Klage, die während der Übergangszeit erhoben worden sei.
Weiterhin hat das Berufungsgericht ausgeführt, dass diese Auslegung auch im Einklang mit dem Sinn und Zweck des Art. 83 EPGÜ stehe.
Die Möglichkeit, vom Opt-out gemäß Art. 83 Abs. 4 EPGÜ zurückzutreten, diene dazu, einem Patentinhaber zu ermöglichen, die Folgen eines früheren Opt-out rückgängig zu machen und das neue EPG-System mit seinen Vorteilen zu nutzen, sobald er sich mit der Funktionsweise des EPG vertraut gemacht habe. Die Einschränkungen der Opt-out Möglichkeit und des Rücktritts nach Art. 83 Abs. 3 bzw. 4 EPGÜ sollen einen Missbrauch dieses Systems durch einen unzulässigen Wechsel der Zuständigkeiten verhindern. Im Einklang mit diesem Zweck sei unter „bereits eine Klage vor einem nationalen Gericht erhoben worden“ eine Klage zu verstehen, die nach Inkrafttreten der Übergangsregelung bei einem nationalen Gericht erhoben worden sei. Davor sei ein Missbrauch gar nicht möglich.
Das Berufungsgericht hat gleichzeitig klargestellt, dass eine andere Auslegung dem Sinn und Zweck des Opt-out- und Rücknahmesystems widersprechen und zu einer Ungleichbehandlung der Inhaber von Patenten führen würde, die in der Vergangenheit Gegenstand eines nationalen Rechtsstreits gewesen seien. Denn würde sich ein Patentinhaber, dessen Patent jemals Gegenstand eines Rechtsstreits vor einem nationalen Gericht gewesen sei, für ein Opt-out entscheiden, wäre ein Rücktritt nicht möglich, was ihn der Möglichkeit berauben würde, das EPG-System und seine Vorteile jemals zu nutzen.
Außerdem hat das Berufungsgericht festgestellt, dass sich der Begriff „Klage“ in Art. 83 EPGÜ nicht nur auf Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen, sondern auf alle in Art. 32 EPGÜ genannten Klagen beziehe, für die das EPG zuständig ist.
III. Ausblick
Diese Entscheidung trägt dazu bei, dass das EPG eine höhere Attraktivität für Patentinhaber erlangt, indem es ihnen erlaubt, unter bestimmten Bedingungen in das EPG-System zurückzukehren, selbst wenn deren Patente von früheren nationalen Verfahren betroffen waren und die sich gegen das neue System entschieden haben.
Anda Soponar

Aktuelle News.
Zu den Voraussetzungen einer drohenden Patentverletzung im Sinne des Art. 62 (1) EPGÜ
Lokalkammer Düsseldorf, Urt. v. 06.09.2024, UPC_CFI_165/2024, UPC_CFI_166/2024 – Novartis / Genentech
In einem Verfahren betreffend den Erlass einstweiliger Maßnahmen hatte sich die Lokalkammer Düsseldorf mit der Frage zu befassen, wann eine Patentverletzung im Sinne des Art. 62 (1) EPGÜ „droht“.
Sachverhalt
Die Antragsstellerin ist Inhaberin des Streitpatents, das eine pharmazeutische Formel betreffend Antikörper-Biosimilars zum Gegenstand hat. Die Antragsgegnerinnen gehören einem Konzern an. Die Antragsgegnerin im parallelen Verfahren UPC_CFI_166/2024 ist die Muttergesellschaft der Antragsgegnerinnen zu 1) bis 7) im Verfahren UPC_CFI_165/2024. Die Muttergesellschaft hält 100% der Anteile an der Antragsgegnerin zu 1), die für das Marketing und den Vertrieb in Europa zuständig ist. Die Antragsgegnerin zu 1) ist hundertprozentige Anteilseignerin an den Antragsgegnerinnen zu 2) bis 7). Die Muttergesellschaft hat ein Biosimilar Produkt entwickelt, das den Antikörper Omalizumab enthält (nachfolgend „angegriffene Ausführungsform“), dessen klinische Studie der Phase III auf einem Vergleich mit dem Produkt der Antragsstellerin basierte, das die patentierte Formel enthält. Zwischen Juli und Oktober 2023 erhoben die Antragsgegnerinnen in mehreren Ländern Nichtigkeitsklage gegen das Streitpatent. Im November 2023 erklärte ein Vertreter der Beklagten in einem koreanischen Nachrichtenportal für das Gesundheitswesen, dass es das Ziel der Antragsgegnerinnen sei, das erste Unternehmen zu sein, dass dieses Antikörper- Biosimilar in wichtige Länder liefert. Kurz darauf übersendete die Antragstellerin eine Berechtigungsanfrage an die Antragsgegnerinnen. Die Antragsgegnerinnen erwiderten, ihr Produkt mache von der Lehre des Streitpatents keinen Gebrauch. Im Übrigen sei das Streitpatent nicht rechtsbeständig. Am 25.03.2024 veröffentliche die Muttergesellschaft eine Pressemitteilung, in der sie ihre Intention äußerte, das Produkt sobald wie möglich auf den europäischen Markt zu bringen, wenn die Europäische Marktzulassung erteilt werde. Im selben Monat nahmen die Antragsgegnerinnen an einer Fachmesse in Belgien teil, wo sie an ihrem Stand Informationen über die angegriffene Ausführungsform anboten. Am 10.04.2024 versendete die Antragsgegnerin zu 2) eine E-Mail an einen potenziellen Kunden, in der sie ihn über das positive Signal für eine baldige Erteilung einer Marktzulassung informierte und gleichzeitig anbot, ihn über relevante Neuigkeiten auf dem Laufenden zu halten.
Die Marktzulassung für die angegriffene Ausführungsform wurde am 16.05.2024 von der Europäischen Arzneimittelagentur erteilt. Die Antragsgegnerinnen haben sodann am 24.04.2024 eine weitere Pressemitteilung über die Marktzulassung veröffentlicht und angekündigt, ihren Marktanteil rasch auszubauen. Daraufhin beantragte die Antragstellerin den Erlass einstweiliger Maßnahmen.
Entscheidung der Lokalkammer
Die Lokalkammer weist den Antrag auf Erlass einstweiliger Maßnahmen zurück und begründet dies mit dem Fehlen einer drohenden Patentverletzung im Sinne des Art. 62 (1) EPGÜ.
Für die Beurteilung, ob eine Patentverletzung unmittelbar bevorsteht, müssen die Gesamtumstände des konkreten Falls betrachtet werden. Es müssen bestimmte Umstände vorliegen, die darauf hindeuten, dass der potenzielle Verletzer bereits die vollständigen Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass die Patentverletzung stattfinden kann. Die Darlegungs- und Beweislast hierfür trägt die Antragstellerin.
Entscheidend ist daher nach Ansicht der Lokalkammer, ob das Verhalten der Antragsgegnerinnen zu dem Schluss führt, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit beabsichtigen, während der Patentlaufzeit ohne weitere Umstände in den Markt einzutreten. Dies ist dann der Fall, wenn die Antragsgegnerinnen ein konkretes Angebot auf dem Markt gemacht haben. Dies verneint die Lokalkammer. Erforderlich wäre gewesen, dass die Antragsgegnerinnen das Präparat mit allen Zulassungen und festen Preisen bewerben, sodass Kunden eine Bestellung aufgeben können. Die potenziellen Kunden sind allerdings mit den Regularien in der Pharma-Branche vertraut und wissen, dass nur eine vage Äußerung zum Markteintritt vorliegt, wenn die Preisbildung noch nicht abgeschlossen wurde.
Somit waren aus Sicht der Lokalkammer noch nicht alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das Produkt unmittelbar auf dem europäischen Markt angeboten wird. Die Ankündigung, nachdem die Marktzulassung erfolgte, reicht hingegen noch nicht aus, da es noch keinen spezifischen Zeitrahmen für die Preisverhandlungen gab oder eine Situation vorlag, in der beispielsweise Proben an potenzielle Kunden geschickt wurden.
Fazit:
Die Entscheidung der Lokalkammer erging im Zusammenhang mit Pharmazeutika, die weitere regulatorische Voraussetzungen erfüllen müssen, um auf den Markt zu gelangen. Die Frage, wann sich die tatsächlichen Anzeichen für einen Markteintritt eines Wettbewerbers so konkretisiert haben, dass der Schutzrechtsinhaber dagegen aufgrund der sog. Erstbegehungsgefahr vorgehen kann, ist allerdings von grundlegender Bedeutung.
Da der hiesige Sachverhalt besonders zu behandeln war, bleibt abzuwarten, inwieweit auch in anderen Sachverhaltskonstellationen ein vergleichbar strenger Maßstab anzusetzen ist. In jedem Fall sollte der Sachverhalt ausführlich dahingehend geprüft werden, ob bereits alle Voraussetzungen erfüllt bzw. Schritte eingeleitet wurden, damit das Produkt unmittelbar auf dem Markt angeboten wird.
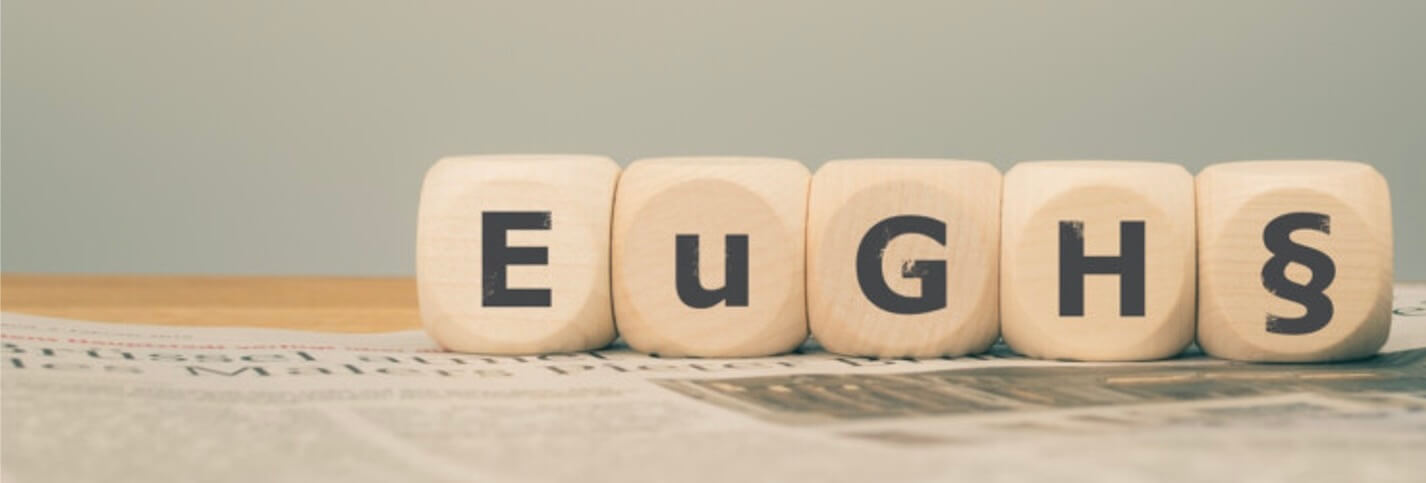
Aktuelle News.
Zur Zustellung der Klageschrift gegenüber ausländischen Beklagten in Verfahren vor dem EPG
Das Berufungsgericht des Einheitlichen Patentgerichts (EPG) hat sich in einer Reihe von Entscheidungen mit der Frage beschäftigt, welche Voraussetzungen an eine Klagezustellung an Beklagte zu stellen sind, die ihren Sitz außerhalb der EPG- und EU-Mitgliedsstaaten haben.
- Anordnung vom 29.07.2024, CoA_69/2024 – APL_8972/2024
- Anordnung vom 29.07.2024, CoA_70/2024 – APL_8977/2024
- Anordnung vom 06.08.2024, CoA_205/2024 – APL_24585/2024
- Anordnung vom 05.08.2024, CoA_183/2024 – APL_21602/2024
- Anordnung vom 05.08.2024, CoA_86/2024 – APL_10370/2024
I. Sachverhalt
Verklagt waren jeweils sowohl Beklagte mit Sitz in den EPG-Mitgliedsstaaten (insbesondere der Bundesrepublik Deutschland; nachfolgend vereinfacht „europäische Beklagte“) also auch Beklagte, die ihren Sitz weder in den EPG-Mitgliedsstaaten noch in den EU-Mitgliedsstaaten hatten (Asien; nachfolgend vereinfacht „asiatische Beklagte“). Bei sämtlichen Beklagten handelt es sich um voneinander unabhängige Gesellschaften innerhalb der Gesamtkonzernstruktur. Zumeist war die asiatische Beklagte höher in der Konzernstruktur angesiedelt (Mutterkonzern).
II. Fragestellung
Die Klägerinnen waren der Ansicht, dass die Klage am Sitz der europäischen Beklagten mit Wirkung gegenüber der asiatischen Beklagten zugestellt werden kann, da diese innerhalb der Konzernstruktur miteinander verwoben sind.
Insoweit verwiesen sie zunächst auf R. 271.5 lit a) EPG VerfO, wonach die Zustellung innerhalb der EPG-Vertragsmitgliedsstaaten an folgendem Ort zu bewirken ist (Hervorhebung hinzugefügt):
„ist der Beklagte eine Gesellschaft oder eine andere juristische Person, an seinem satzungsgemäßen Sitz, seiner Hauptverwaltung oder dem Sitz seiner Hauptniederlassung innerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten oder an jedem anderen Ort innerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten, an dem die Gesellschaft oder andere juristische Person einen dauerhaften oder vorübergehenden Geschäftssitz hat“
Die Differenzierung innerhalb der ersten Variante ist vorliegend nicht Belang, sodass im Folgenden lediglich von „Hauptsitz“ und „Geschäftssitz“ einer Beklagten die Rede ist.
Weiterhin verwiesen die Beklagten auf R. 275 EPG VerfO. Diese regelt in Abs. 1:
„Konnte eine Zustellung nach Abschnitt 1 oder 2 nicht vorgenommen werden, kann das Gericht auf Antrag des Klägers die Zustellung nach einem alternativen Verfahren oder an einem anderen Ort durch Anordnung zulassen, wenn es der Auffassung ist, dass gute Gründe dafür vorliegen, die Zustellung nach einem nach diesem Kapitel sonst nicht vorgesehenen Verfahren oder an einem nach diesem Kapitel sonst nicht vorgesehenen Ort zu gestatten.“
In Abs. 2 heißt es:
„Auf einen mit einer Begründung versehenen Antrag des Klägers kann das Gericht anordnen, dass die Schritte, die bereits unternommen wurden, um dem Beklagten die Klageschrift nach einem alternativen Verfahren oder an einem anderen Ort zur Kenntnis zu bringen, eine rechtsgültige Zustellung darstellen.“
III. Lokalkammern lehnten wirksame Zustellung ab
Die Lokalkammern stellten in ihren Anordnungen fest, dass die Anwendung der R. 275 EPG VerfO jedenfalls einen vorherigen Zustellungsversuch voraussetze. Dieser Zustellungsversuch könne nicht bei einer anderen juristischen Person erfolgen, da sonst die Gefahr bestehe, dass höherrangige Zustellungsvorschriften ausgehebelt würden (vgl. etwa Anordnung der Lokalkammer Mannheim vom 09.02.2024 – UPC_CFI_223/2023).
IV. Relevante EuGH-Rechtsprechung:
Die Lokalkammern bezogen sich dabei maßgeblich auf die Rechtsprechung des EuGH.
Dieser hat bereits in seinem Urt v. 19.12.2012 – C-325/11, EuZW 2013, 187 – Alder klargestellt, dass der nationale Gesetzgeber höherrangige Zustellungsregelungen, wie die EuZVO ((EG) Nr. 2020/1784, damals noch (EG) Nr. 1393/2007) nicht aushebeln darf. Nationale Zustellungsregelungen sind daher so auszulegen, dass sie nicht gezielt den Anwendungsbereich höherrangiger Zustellungsregelungen begrenzen, indem sie etwa festlegen, dass in bestimmten Fällen ein Schriftstück nicht körperlich in das Ausland zu übermitteln ist. Kann die nationale Vorschrift nicht europarechtskonform ausgelegt werden, ist sie europarechtswidrig.
Weiter hat der EuGH t kürzlich entschieden, dass Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und Art. 101 AEUV in Verbindung mit der EUZVO (noch Verordnung (EG) Nr. 1393/2007 […]) dahin auszulegen sind, dass
„eine Muttergesellschaft, gegen die eine Klage auf Ersatz des durch eine Zuwiderhandlung gegen das Wettbewerbsrecht verursachten Schadens erhoben wurde, nicht rechtswirksam geladen wurde, wenn die Zustellung des verfahrenseinleitenden Schriftstücks an der Adresse ihrer im Mitgliedstaat der Klageerhebung ansässigen Tochtergesellschaft erfolgte; dies gilt auch dann, wenn die Muttergesellschaft mit dieser Tochtergesellschaft eine wirtschaftliche Einheit bildet.“
EuGH, Urteil vom 11.07.2024 – C-632/22, NZKart 2024, 446 – Volvo
Der EuGH bestärkt damit die Unabhängigkeit von Gesellschaften, selbst wenn sie demselben Konzern angehören.
Die Entscheidung ist wegen ihres rechtlichen Aufhängers an Art. 47 der Charta der Grundrechte und der EuZVO auch auf andere Rechtsgebiete als das Kartellrecht übertragbar, vgl. Rz. 54 der Entscheidung. Art. 47 der Charta der Grundrechte gewährt seine Recht hierüber hinaus auch Beklagten aus Nicht-EU-Staaten, da Art. 47 nicht darauf abstellt, wo jemand ansässig ist, sondern, ob seine Rechte innerhalb der EU betroffen sind, also auch innerhalb eines europäischen Gerichtsprozesses.
V. EPG-Berufungsgericht bestätigt, dass Zustellung nicht wirksam
Unter Berücksichtigung der zitierten Rechtsprechung des EuGH ordnete das EPG-Berufungsgericht an, dass zuerst ein verfahrensrechtlich vorgesehener Zustellungsversuch erfolgen muss, bevor die Zustellung durch alternative Verfahren oder an einem alternativen Ort (R. 275 EPG VerfO) zulässig ist. R. 275.2 EPG VerfO setzt lso wie R. 275. 1 EPG VerfO einen verfahrensrechtlich vorgesehenen Zustellungsversuch voraussetzt. Der Wortlaut lässt dies offen zwar offen. Die Systematik und die Gefahr, dass internationale Zustellungsregelungen ausgehebelt werden (s.o.) sprechen nach Ansicht des EPG- Berufungsgerichts jedoch dafür.
Das EPG-Berufungsgericht geht sodann der Frage nach, ob ein tauglicher Zustellungsversuch am Sitz der europäischen Beklagten mit Wirkung gegenüber der asiatischen Beklagten nach R. 271.5 lit a) EPG VerfO vorliegt. Genau genommen wäre bei Bejahung dieser Frage die Zustellung schon ipso iure erfolgt. Die Klägerinnen vertraten daher vereinzelt die Auffassung, dass R. 275 Abs. 2 EPG VerfO dem Gericht auch in diesem Fall die (Feststellungs) Befugnis gibt, anzuordnen, dass eine rechtsgültige Zustellung erfolgt ist.
Das EPG-Berufungsgericht entschied, dass sich aus dem Wortlaut von R.271.5 lit. a) EPG VerfO deutlich ergebe, dass (Hervorhebung hinzugefügt)
„er nur für Zustellungen an Gesellschaften oder andere juristische Personen gilt, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung in den Vertragsmitgliedstaaten haben. Dies wird durch die Wahl der Formulierung im zweiten Teil des Satzes deutlich, in dem auf „die Gesellschaft“ Bezug genommen wird. Der Verweis auf „die Gesellschaft“ verweist auf den ersten Teil des Satzes, in dem eine solche Gesellschaft definiert wird, d.h. eine Gesellschaft mit satzungsmäßigem Sitz, Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung in den Vertragsmitgliedstaaten.
Der Wortlaut des zweiten Teils von R.271.5 lit. a) VerfO sieht somit Orte vor, an denen die Zustellung im EPG-Gebiet erfolgen kann, als Alternative zur Zustellung an eine Gesellschaft mit satzungsmäßigem Sitz, Hauptverwaltung oder Hauptniederlassung in den Vertragsmitgliedstaaten. Diese Bestimmung sieht also alternative Zustellungsorte für einen Beklagten vor, der im EPG-Gebiet ansässig ist. Die Zustellung kann dann an jedem anderen Ort innerhalb der Vertragsmitgliedstaaten erfolgen, an dem die Gesellschaft oder andere juristische Person einen dauerhaften oder vorübergehenden Geschäftssitz hat.“
- 271.5 lit a) EPG VerfO ist nach dem EPG-Berufungsgericht daher in jedem Fall nur auf Beklagte anwendbar, die ihren Hauptsitz innerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten haben. Europäische Beklagte können daher kein dauerhafter oder vorübergehender Geschäftssitz einer asiatischen Beklagten sein.
Das EPG-Berufungsgericht schließt insoweit grundsätzlich eine Auslegung von 271.5 lit a) zweite Alternative EPG VerfO, wonach einer asiatischen Beklagten (Hauptsitz außerhalb der EPG-Vertragsmitgliedsstaaten) jemals eine Klage innerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten zugestellt werden kann, selbst wenn diese dort nach eigenen Angaben einen vorübergehenden oder dauerhaften Geschäftssitz eingerichtet hat.
VI. Bewertung und praktische Auswirkungen
Juristisch nachvollziehbar ist aufgrund der gesellschaftsrechtlichen Trennung der Beklagten noch, dass bei Tochtergesellschaften keine Zustellung gegenüber der Muttergesellschaft erfolgen kann (vgl. EuGH Volvo oben).
Die weitere Auslegung des EPG-Berufungsgerichts erscheint jedoch nach Auffassung des Autors zu eng, insbesondere mit Blick auf die einschlägige EuGH-Rechtsprechung (Aldar). Der EuGH macht klar, dass es lediglich darum geht, zu verhindern, dass dem Beklagten ein Schriftstück, etwa eine Klage, tatsächlich nicht körperlich erreicht (sog. fiktive Inlandszustellung). Unterhält ein Beklagter innerhalb der Vertragsmitgliedsstaaten aber einen vorübergehenden oder dauerhaften Geschäftssitz, muss er sich hieran festhalten lassen und hier eine Zustellung gegen sich gelten lassen. Im Einzelfall ist natürlich zu prüfen, ob ein Geschäftssitz im Sinne der Vorschrift vorliegt.
Entsprechend erlaubt die deutsche ZPO die Zustellung an jedem Ort, an dem eine Person angetroffen wird, vgl. § 177 ZPO. In Messesachen kann ferner § 178 Abs. 1 ZPO herangezogen werden. Ein Messestand gilt üblicherweise als Geschäftsraum in diesem Sinne.
Nach der Rechtsprechung des EPG-Berufungsgerichts wäre es hingegen bspw. unmöglich, in Verfahren über einstweiligen Maßnahmen schnell eine Einstweilige Anordnung etwa am Messestand einer asiatischen Beklagten zuzustellen, vgl. R. 276 EGP VerfO, der auf die vorherigen Zustellungsregelungen, also auch R. 271.5 lit a) EGP VerfO verweist. Dies ist insbesondere erforderlich, wenn der Antragsgegner noch nicht anwaltlich vertreten ist.
Es ist daher zu hoffen, dass das EPG-Berufungsgericht diese Rechtsprechung in Zukunft noch einmal in den Blick nehmen wird.
Robert Knaps

Aktuelle News.
JUVE Patent Ranking Germany 2024 – 5 Stars für Kather Augenstein
Wir freuen uns sehr, dass Kather Augenstein im heute veröffentlichten JUVE Patent Ranking Germany 2024 in der Kategorie Litigation: Lawyers mit 5 Stars ausgezeichnet wurde. Mit dieser besonderen Anerkennung hat unsere Boutique-Kanzlei in diesem Jahr die Top Position Tier 1 erreicht und zählt damit zu den führenden IP-Spezialisten in Deutschland.
Ein herzlicher Glückwunsch geht an unsere Recommended und Leading Individuals, Dr. Peter Kather, Dr. Christof Augenstein, Christopher Weber und Miriam Kiefer LL.M., sowie an das gesamte Team von Kather Augenstein für diese herausragende Leistung.
In seiner diesjährigen Bewertung hebt JUVE Patent die besondere Schlagkraft unseres Expertenteams in komplexen Verfahren vor nationalen Gerichten und dem UPC hervor. „Das Team ist bereits jetzt eines der aktivsten am neuen Gericht und bearbeitet eine signifikante Anzahl hochkarätiger Fälle aus einer Vielzahl von Branchen, darunter mobile Kommunikation, Automobilindustrie und Medizintechnik.“
Im aktuellen Ranking werden besonders erwähnt: Christof Augenstein, der als „kreativ, praxisnah und reaktionsschnell“ von Mandanten sowie als „freundlich, aber bestimmt“ von Wettbewerbern beschrieben wird; Peter Kather, der als „sehr mandantenorientiert mit herausragender Strategie- und Verfahrensberatung“ von Mandanten sowie als „sehr erfahren“ von Wettbewerbern geschätzt wird; Miriam Kiefer, die für ihr „hervorragendes Case Management und ihre Fähigkeit, auf Mandantenbedürfnisse einzugehen“, anerkannt wird und Christopher Weber, der für seine „technische Expertise und internationale Versiertheit“ besonders hervorgehoben wird.
Das vollständige Ranking finden Sie hier.

Aktuelle News.
Juristinnen erzählen – Dr. Katharina Brandt als Gast im Interviewpodcast des ITM Münster
In der 10. Folge der Podcastserie „Juristinnen erzählen“ des ITM Münster hat Dr. Katharina Brandt die Gelegenheit, über ihren Berufseinstieg bei Kather Augenstein zu berichten. Im Interview mit Katharina Börms teilt Sie ihre Begeisterung für das Patentrecht sowie einige der Herausforderungen, denen sie als junge Anwältin begegnete.
Während ihres Studiengangs der Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt im Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht (ITM) an der Universität Münster absolvierte Katharina u.a. eine Zusatzausbildung im Gewerblichen Rechtsschutz. Nach ihrem ersten Examen promovierte sie im Patentrecht und trat 2021 als Associate bei Kather Augenstein ein. Seitdem berät und vertritt sie nationale und internationale Unternehmen verschiedener Branchen in allen Bereichen des Gewerblichen Rechtsschutzes, wobei ihr Tätigkeitsschwerpunkt im Patentrecht liegt.
Dieses Interview richtet sich besonders an Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger sowie alle, die sich noch in der Ausbildung befinden.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Anhören! Hier geht es zum Podcast.

Aktuelle News.
Vorläufiger Geheimnisschutz in Eilverfahren vor dem EPG
Lokalkammer Düsseldorf, Verfahrensanordnung v. 23.02.2024 – UPC_CFI_463/2023 – 10x Genomics/Curio Bioscience
In seiner Verfahrensanordnung vom 23.02.2024 hat sich die Lokalkammer Düsseldorf mit der Frage auseinandergesetzt, wie vorläufiger Geheimnisschutz in Eilsachen zu gewährleisten ist.
I. Sachverhalt
Am 04.12.2023 stellte die Antragstellerin bei der Lokalkammer Düsseldorf einen Antrag auf Anordnung einstweiliger Maßnahmen.
Vor Ablauf der Einspruchsfrist (R. 209.1 (a) VerfO) und vor Einreichung der Einspruchsschrift beantragte die Antragsgegnerin die Anordnung von Maßnahmen zum vorläufigen Schutz vertraulicher Informationen. Mit Verfahrensanordnung vom 14.02.2024 stellte die Lokalkammer ihre Entscheidung über die Anträge zurück, bis die Antragsgegnerin ihren Einspruchsschriftsatz eingereicht und einen Antrag auf den Schutz vertraulicher Informationen gestellt hat. In diesem Zusammenhang erläuterte sie auch das durch das Case Management System vorgesehene abgestufte Verfahren des Geheimnisschutzes, nachdem die Kammer zunächst Anordnungen zum vorläufigen Schutz der (vermeintlich) geheimhaltungsbedürftigen Dokumente treffen kann.
Mit Einreichung der Einspruchsschrift nebst Anlagen beantragte am 15.02.2024 beantragte die Antragsgegnerin den Schutz der dort enthaltenen, vertraulichen Informationen. Mit einer Verfahrensanordnung vom 16.02.2024 räumte die Lokalkammer den bisher im Verfahren benannten Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin Zugang zur ungeschwärzten Fassung der vorgelegten Dokumente ein und verpflichtete diese unter Androhung von Zwangsgeldern – auch gegenüber der Antragstellerin – zur Geheimhaltung. Zugleich erhielten die Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme, welche Personen bis zur endgültigen Entscheidung über den Geheimnisschutz Zugang zu den Informationen erhalten sollten.
Die Antragsgegnerin beantragte, dass der Zugang zu den Informationen auf vier namentlich bekannte Rechtsvertreter zu beschränken sei, die sich verpflichten, 5 Jahre lang an keinen Lizenzverhandlungen im Bereich der patentgemäßen Lehre teilzunehmen. Hilfsweise sollte zusätzlich ein Mitarbeiter der Antragstellerin aus der Rechtsabteilung, der ebenfalls an keinen geschäftlichen Entscheidungen beteiligt ist, Zugang erhalten, wobei auch dieser sich verpflichten solle, 5 Jahre lang an keinen Lizenzverhandlungen im Bereich der patentgemäßen Lehre teilzunehmen.
Die Antragstellerin beantragte demgegenüber Zugang zu den (vermeintlich) vertraulichen Informationen für die Rechtsanwälte der von der Antragstellerin mandatierten Kanzlei, sowie für zwei namentlich benannte, zuverlässige Personen bei der Antragstellerin. Hilfsweise beantragte sie Zugang für die mit dem Verfahren betrauten Rechtsanwälte der von der Antragstellerin mandatierten Kanzlei, zwei Rechtsanwaltsfachangestellte sowie die zwei benannten, zuverlässigen Personen bei der Antragstellerin.
II. Anordnung der Lokalkammer Düsseldorf
In der vorläufigen Geheimhaltungsanordnung beschränkt die Lokalkammer Düsseldorf den Zugang zu den geschwärzten Informationen bis zu einer abschließenden Entscheidung über den Geheimnisschutzantrag auf Seiten der Antragstellerin auf die mit dem Verfahren betrauten Rechtsanwälte der von der Antragstellerin mandatierten Kanzlei, zwei Rechtsanwaltsfachangestellte und eine der benannten, zuverlässigen Personen bei der Antragstellerin. Die Personen sind zur Geheimhaltung auch gegenüber der Antragstellerin verpflichtet. Die Informationen dürfen außerhalb des Verfahrens nicht offengelegt werden. Die Antragstellerin hat sicherzustellen, dass nur die zuverlässige Person Zugang zu den Informationen hat.
Ausgehend von Art. 9 Abs. 1 und 2 lit. a) RiLi (EU) 2016/943, Art. 58 EPGÜ und R.262 VerfO stellt die Kammer fest, dass der Zugang zu (angeblichen) Geschäftsgeheimnissen auf eine begrenzte Anzahl von Personen beschränkt werden kann. Bis zu endgültigen Geheimnisschutzanordnung kann der Zugang noch weiter eingegrenzt werden, um einen effektiven Geheimnisschutz zu gewährleisten. Der Geheimnisschutzantrag kann auch mit den geschwärzten Versionen der betroffenen Dokumente mit der Partei erörtert werden.
Im vorliegenden Fall darf allerdings nicht die Besonderheiten des Eilverfahrens außer Acht gelassen werden. Stellungnahmefristen sind kurz bemessen. Fristverlängerungen sind in der Regel ausgeschlossen, der Termin zur mündlichen Verhandlung steht häufig kurzfristig an. All dies muss bei der Bestimmung des Personenkreises, der Zugang zu den Informationen erhalten soll, berücksichtigt werden, um ein faires Verfahren zu gewährleisten. Die von der vorläufigen Geheimnisschutzanordnung betroffene Partei muss entsprechend unter Berücksichtigung des Geheimhaltungsinteresses der Gegenseite vollumfänglich arbeitsfähig und in der Lage sein, in der Sache zu jedem durch die Gegenseite aufgeworfenen Punkt Stellung zu nehmen. Im Einklang mit seiner Anordnung vom 14.Februar 2024 gelangt die Lokalkammer so zu dem vorläufigen Ergebnis, dass im Eilverfahren in der Regel vier rechtsanwaltlichen Vertretern (zwei Partner und zwei Associates zu deren Unterstützung), zwei patentanwaltlichen Vertreter sowie drei Vertretern der Mandantin Zugang einzuräumen ist, wobei dieser Personenkreis bei Bedarf um zwei Rechtsanwaltsfachangestellte erweitert werden kann. Dies unterliegt jedoch wiederum einer Einzelfallprüfung, da der Personenkreis gemäß R. 262.6 S. 1 VerfO den für die Einhaltung des Rechts der Verfahrensbeteiligten auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires Verfahren notwendigen Umfang nicht überschreiten darf.
Auf den vorliegenden Fall angewandt stellt die Lokallkammer fest:
1). Den Patentanwälten der Antragstellerin ist kein Zugang zu gewähren, da die geschwärzten Informationen rein kommerzieller und nichttechnischer Natur sind.
2). Soweit die Antragstellerin Zugang für drei Partner und einen Associate der mandatierten Kanzlei beantragt, hat die Lokalkammer keine Bedenken. Eine Beschränkung des Zugangs auf solche Rechtsvertreter, die nicht an anhängigen und dasselbe Rechtsgebiet betreffenden Verfahren vor dem EPG beteiligt sind, würde die Antragstellerin unangemessen in der Wahl ihrer Rechtsvertreter einschränken. Zudem würden die Rechtsvertreter erheblich in ihrer Berufsausübung behindert, ohne dass dies durch überwiegende Interessen auf Antragsgegnerseite gerechtfertigt wäre. Hinreichender Schutz ist durch die Geheimhaltungsanordnung unter Androhung von Zwangsmitteln gewährleistet.
3). Im Übrigen ist der Zugang auf den im Hilfsantrag der Antragstellerin benannten Mitarbeiter bei der Antragstellerin zu beschränken, die nach Auskunft der Antragstellerin ihre patentrechtlichen Streitigkeiten maßgeblich koordiniert und die zentrale interne Person in der täglichen Bearbeitung der Prozessführung der Antragstellerin ist. Sowohl Art. 9 RiLi (EU) 2016/943 als auch R262a.6 VerfO sehen vor, dass mindestens einer natürlichen Person der Partei Zugang zu gewähren ist. Dass dieser Mitarbeiter möglicherweise an kommerziellen Entscheidungen der Antragstellerin beteiligt ist, ohne dass dies näher dargetan ist, rechtfertigt keine andere Entscheidung. Die Geheimhaltungsanordnung unter Androhung von Zwangsgeldern bietet auch insoweit ausreichend Schutz. Entsprechend muss die Antragstellerin auch nicht nachweisen, dass sie Verfahren zum Schutz der geschwärzten Informationen implementiert hat. Die Anordnung einer Verpflichtung, fünf Jahre lang an keinen Lizenzverhandlungen im Bereich der patentgemäßen Lehre teilzunehmen, würde unverhältnismäßig in dessen Recht auf Berufsausübung eingreifen.
Kristin Jochheim & Charlotte George

Aktuelle News.
Leaders League Rankings 2024 – Kather Augenstein erneut als eine der führenden Rechtsanwaltskanzleien für Patent- und Markenstreitigkeiten ausgezeichnet
Bei den diesjährigen Leaders League Rankings 2024 wurde Kather Augenstein zum wiederholten Mal als eine der führenden Rechtsanwaltskanzleien im gewerblichen Rechtsschutz für Patent- und Markenstreitigkeiten ausgezeichnet.
Dabei wurde das Team von Kather Augenstein in der neuen Leaders League Rankingliste in der Kategorie Patentstreitigkeiten mit dem Prädikat „ausgezeichnet“ Tier 1 bewertet und darüber hinaus im Bereich Markenrechtstreitigkeiten mit dem Prädikat „sehr empfehlenswert“ ausgezeichnet.
Weitere Informationen zu unserem Team finden Sie hier.
