
Aktuelle News.
MIP Ranking: Dr. Benjamin Pesch wird von der führenden Fachpublikation Managing Intellectual Property als „Rising Star 2021“ ausgezeichnet
Wir freuen uns, dass Dr. Benjamin Pesch in der kürzlich erschienenen Veröffentlichung von Managing IP als „Rising Star 2021“ in Deutschland ausgezeichnet wurde.
In dieser Fachpublikation werden die besten aufstrebenden Rechts- und Patentanwälte im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes vorgestellt, die zum Erfolg ihrer Kanzlei und ihrer Mandanten beitragen. Herzlichen Glückwunsch, Benjamin, zu dieser Ernennung!
Managing Intellectual Property hat in diesem Jahr bereits die folgenden Kather Augenstein Anwälte als IP Stars 2021 in Deutschland ausgezeichnet.

Aktuelle News.
OLG Düsseldorf: Patentverletzendes Anbieten durch Benennung eines Referenzobjekts und andere Sorgen
OLG Düsseldorf, Urteil vom 15.07.2021 – 15 U 42/20. In seiner Entscheidung hatte der 15. Senat gleich mehrere Probleme zu lösen. Die Beklagte bestritt nicht nur patentverletzende Handlungen, sondern auch die Aktivlegitimation der Klägerin wegen Formunwirksamkeit einer Abtretungserklärung. Zudem war sie der Auffassung, dass der Rückrufanspruchs unverhältnismäßig sei.
I. Sachverhalt
Das Klagepatent betrifft eine sog. Montage- und Reparaturgrube in Form einer ein- oder mehrteiligen Kassette. Das Besondere an der geschützten Grube sind zwei Wassersammelrinnen, die sich längs der oberen Begrenzung der Längsseitenwänden erstrecken, und durch Laufroste abgedeckt sind. Die Sammelrinnen fangen vom Fahrzeug ablaufendes Wasser auf und entsorgen es. Die Laufroste gewährleisten die Befahrbarkeit.
Die Klägerin ist seit 2017 Inhaberin des Klagepatents. Mit schriftlicher Vereinbarung erteilte die ursprüngliche Inhaberin der Klägerin unentgeltlich eine einfache Lizenz und trat ihr alle vergangenen und zukünftigen Schadensersatz- und Auskunftsansprüche ab. Die Beklagte bietet Montagegruben an, plant die Installation und vertreibt sie unter der Bezeichnung P. Der Kunde kann die Gruben modular konfigurieren, die die Beklagte liefert und montiert.
Für den Einbau einer Arbeits- und Montagegrube bei einer Autobahnmeisterei wurde ein Projekt ausgeschrieben. Die entsprechende Angebotsaufforderung sah für die zu errichtende Grube „Entwässerungsrinnen links und rechts“ sowie die Aufnahme von befahrbaren Gitterrosten vor. Nach der Abgabe eines Angebots erhielt die Beklagte den Zuschlag. Die danach ausgearbeiteten Konstruktionspläne waren mit dem Logo der Beklagte versehen.
Die Grube, die schließlich bei der Autobahnmeisterei installiert wurde, verwirklicht unstreitig alle Merkmale des Hauptanspruchs. Die Beklagte bewarb die dort installierte Grube auf ihrer Webseite damit, dass sie die „komplette technische Werkstattausstattung“ lieferte, unter anderem eine „P“. Laut Werbung bestand die Grube aus einem Stahlfertigteil mit Rollabdeckung, Abtropfrinnen und Altölentsorgung.
Einigkeit bestand also darüber, dass die Beklagte eine Grube geliefert hat. Streitig war jedoch die Frage, ob die Beklagte auch die Wassersammelrinnen und Laufroste lieferte und montierte.
II. OLG bestätigt die Entscheidung des LG
Wie schon das LG, bejahte das OLG die Aktivlegitimation mit dem Hinweis auf die grundsätzliche Formfreiheit der Abtretungserklärung. Die Übertragung von Annexansprüchen als Verfügungsgeschäft sei auch dann formfrei möglich, wenn das der Abtretung zugrunde liegende Kausalgeschäft formbedürftig ist.
Das OLG beurteilte gleich zwei Handlungen als patentverletzend. Zum einen sah es in der Werbung mit dem patentverletzenden Referenzobjekt ein Angebot im Sinne von § 9 PatG. Denn die Beklagte erwecke so den Eindruck, eine solche Grube liefern zu können. Da dem Verkehrskreis bekannt bzw. für ihn ermittelbar sei, dass der unstreitig patentverletzende Gegenstand existiere, sei es auch unerheblich, dass die Beklagte nicht alle Merkmale der geschützten Lehre beworben hatte. Entscheidend sei dafür, dass der Verkehr auf die nicht beworbenen Merkmale aus sonstigen objektiven Gesichtspunkten schließen könne. Auf eine freie Zugänglichkeit dieser Information käme es dagegen nicht an. Zum anderen stelle auch die Abgabe des Angebots, da es auf die Angebotsaufforderung erfolgte, ein Angebot im Sinne des Patentgesetzes dar. Denn damit sei der Abschluss eines Vertrages über eine Grube mit genau diesen, patentverletzenden Eigenschaften vorbereitet und gefördert worden sei.
Ohne eine Beweisaufnahme gelangte das OLG zu der Überzeugung, dass die Beklagte auch die Wassersammelrinnen und die Laufroste lieferte und damit eine patentverletzende Montagegrube in den Verkehr brachte. Das OLG sah die von der Klägerin vorgetragenen Tatsachen als nicht beweisbedürftig an, da die Beklagte dem Vortrag der Klägerin nicht hinreichend substantiiert entgegentreten war. Dem umfangreichen und schlüssigen Vortrag der Klägerin (u. a. Eingehung der schuldrechtlichen Verpflichtung zur Lieferung gemäß der Ausschreibung; Konstruktionsplan mit Logo der Beklagten; Abrechnung mit Gruben-Typenbezeichnung gemäß der Ausschreibung) stand die pauschale Behauptung gegenüber, dass der Geschäftsführer der Beklagten darauf hingewiesen habe, dass die Beklagte keine Grube mit Rinnen und Rosten liefern könne und werde. Insbesondere angesichts der Abgabe des Angebots auf die spezifische Angebotsaufforderung, überzeugte dies das Gericht nicht.
Die Beklagte hatte in der Berufungsinstanz erstmalig vorgetragen, dass der Rückruf unverhältnismäßig sei, da die Demontage sehr aufwendig sei und zur vollständigen Zerstörung der Anlage führen würde. Es sei daher nicht damit zu rechnen, dass die Kunden dem Rückruf nachkommen würden. Eine Begründung für die vermeintliche Zerstörung lieferte die Beklagte allerdings nicht. Das OLG wies den Einwand als verspätet zurück und sah zudem keine Anhaltspunkte für eine Unverhältnismäßigkeit des Rückrufs. Da bei einem Rückrufanspruch lediglich die ernsthafte Aufforderung an die gewerblichen Besitzer und gerade kein Erfolg des Rückrufs geschuldet sei, käme es nicht darauf an, dass sich der Rückruf u. U. als erfolglos erweisen könnte. Zudem sei das mildere Mittel des Ausbauens der Rinnen und Roste nicht gleich effektiv, da dies nur eine vorrübergehende Störungsbeseitigung darstellen würde. Entsprechend der gängigen Düsseldorfer Spruchpraxis stellte das OLG auch einen Anspruch gegen gewerbliche Endverbraucher fest, da eine Zerstörung nicht offensichtlich und die Weiterveräußerung daher nicht auszuschließen sei.
III. Keine Überraschung aus Düsseldorf
Die Formfreiheit der Abtretungserklärung unabhängig vom zugrunde liegenden Kausalgeschäft ist herrschende Meinung. Sie steht auch nicht im Widerspruch zum Schutzzweck (Übereilungsschutz) des § 518 BGB. Denn dieser ist ausreichend auf der Ebene des schuldrechtlichen Kausalgeschäfts gewährleistet.
Dass das OLG in der Werbung mit einem Referenzobjekt ein Angebot gesehen hat, steht im Einklang mit dem sehr weiten und rein wirtschaftlichen Verständnis des Angebots i. S. d. § 9 S. 2 Nr. 1 PatG. Im Unterschied zu § 145 BGB ist es bei § 9 PatG ausreichend, dass eine Nachfrage geschaffen wird, deren Befriedigung durch das Angebot in Aussicht gestellt wird. Dies tut die Beklagte, indem sie das Referenzobjekt bewirbt und das Angebot im Vergabeverfahren abgibt.
Es ist ebenfalls wenig überraschend, dass das OLG den Einwand der Unverhältnismäßigkeit, den die Beklagte richtigerweise im Erkenntnisverfahren vorgebracht hat, abgelehnt hat. Die Unverhältnismäßigkeit gem. § 140 Abs. 4 PatG ist als Ausnahmetatbestand eng auszulegen. Nur wenn die Interessen des Verletzers oder berechtigte Interessen Dritter überwiegen, kann eine Unverhältnismäßigkeit angenommen werden. Im Rahmen des Rückrufanspruchs sind jedoch nur extreme Ausnahmefälle denkbar. Da im Rahmen des Rückrufanspruchs kein Erfolg geschuldet sei, kann die (vermeintliche) Erfolglosigkeit für die Unverhältnismäßigkeit keine Rolle spielen.

Aktuelle News
Video: Vortrag von Dr. Peter Kather und Dr. Christof Augenstein bei diesjährigem Herbstseminar des Bundesverband Deutscher Patentanwälte
Das diesjährige Herbstseminar des BDPA zum Thema „Patentverletzung im Visier – Strategische Aspekte von der Vermeidung bis zur Durchsetzung“ fand am 07. und 08. Oktober 2021 in Düsseldorf statt. Die Veranstaltungsreihe wurde per Livestream übertragen.
Wir freuen uns über die große Resonanz und das Interesse am Vortrag von Dr. Peter Kather und Dr. Christof Augenstein zum Thema „Deutscher Patentverletzungsprozess – Taktiken offengelegt im Dialog“. Im Nachgang stellt der BDPA den vollständige Videomitschnitt nun hier zur Verfügung.

Aktuelle News.
JUVE Patent Ranking 2021: Kather Augenstein erneut unter den Top-IP Boutique Kanzleien und führenden IP Spezialisten in Deutschland
Jedes Jahr aufs Neue werden Kanzleien in Rankings umfassenden Bewertungen unterzogen. Wir freuen uns sehr, dass unsere Boutique-Kanzlei auch in diesem Jahr in der aktuellen Ausgabe des hochkarätigen JUVE Patent Ranking 2021 die Platzierung der vergangenen Jahre verteidigen konnte. Nach wie vor sind wir mit vier Sternen in der zweithöchsten Bewertung ausgezeichnet und in der dritthöchsten Gruppe der Patent Anwälte gelistet.
Weiter sind wir erneut in der Kategorie Führende Berater/Leading Individuals vertreten. Neben unserem Senior Partner Dr. Peter Kather wird in diesem Jahr zusätzlich auch unser Partner Christopher Weber als führender Berater unter Prozessanwälten im Patentrecht besonders hervorgehoben.
Ein besonderer Dank gilt unseren Mitstreitern und Mandanten, die gleich vier unserer Partner und IP Spezialisten besonderes Lob aussprechen und Dr. Peter Kather als „erfahren und hervorragend“, Miriam Kiefer als „sehr mandantenorientiert“, Christopher Weber als „technisch versiert, international aufgestellt und hoch fokussiert“ anerkennen. Mandanten unterstrichen außerdem die Arbeitsweise unseres Namensgebers Dr. Christof Augenstein als „grandios, wie schnell er im Fall ist“.
„Die besondere Auszeichnung unserer Kanzlei ist nie das Ergebnis einer einzelnen Person, sondern die unseres gesamten Teams. Das aktuelle JUVE Patent Ranking 2021 basiert auf dem Feedback unserer Mandanten und Mitstreiter, wir sehen dies als Ansporn für zukünftige Erfolge und danken den Expertinnen und Experten für ihre Empfehlungen“, so Dr. Christof Augenstein.

Aktuelle News
Update: Österreich steht kurz vor der Ratifizierung des Protokoll über die vorläufige Anwendung des Übereinkommens über ein einheitliches Patentgericht
In seinem Bericht vom 11. November hat der Parlamentsausschuss für Forschung, Innovation und Digitalisierung der Republik Österreich einstimmig beschlossen, dem Plenum die Ratifizierung des PPA zu empfehlen (siehe beigefügter Bericht). Das Protokoll zum Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht über die vorläufige Anwendung (PPA) steht nun an Stelle 12 auf der Tagesordnung der Sitzung des österreichischen Parlaments am 19. November 2021. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass das Parlament das PPA noch in dieser Woche annehmen wird.
Mit der Errichtung des Einheitspatents („Patent mit einheitlicher Wirkung“) und zugehörig dem Einheitlichen Patentgericht wird sichergestellt, dass die Patentinhaber und Patentinhaberinnen ihre Patente vor einem einzigen Gericht – dem Einheitlichen Patentgericht – durchsetzen und verteidigen können. Als erster Mitgliedstaat hatte Österreich dem multilateralen Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) zugestimmt (Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde am 6.8.2013).
Damit das Einheitliche Patentgericht bereits von Anfang an arbeitsfähig ist, müssen umfangreiche Vorbereitungen getroffen werden. Dies erfordert eine vorläufige Anwendbarkeit von Teilen des EPGÜ in einer Vorlaufphase vor dem Inkrafttreten.
Zu diesem Zweck hat der vorbereitende Ausschuss des Einheitlichen Patentgerichts das Protokoll über die vorläufige Anwendung (PPA) vorgelegt. Das vorliegende Protokoll soll nun mit dem gegenständlichen Rechtsakt für Österreich anwendbar werden.
Die vorläufige Umsetzung während einer „Vorlaufphase“ ermöglicht es, umfangreiche Vorbereitungen zu treffen, damit das Einheitliche Patentgericht bereits am ersten Tag des Inkrafttretens seine Arbeit aufnehmen kann. Damit wäre ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Einheitlichen Patentgericht vollzogen, das dann voraussichtlich Ende 2022/Anfang 2023 seine Arbeit aufnehmen wird.
Bereits im Juli diesen Jahres hatten wir in unserem Blog ausführlich zu den Entscheidungen in Deutschland berichtet, dort bieten wir eine detaillierte Analyse in Deutsch und Englisch zum Download an.
Zum aktuellen Stand des Einheitlichen Patentgericht (UPC) interviewte unser Partner Dr. Christof Augenstein kürzlich den Vorsitzenden des Vorbereitungsausschusses, Alexander Ramsay, während des AIPPI-Online-Kongresses am 21. Oktober 2021. Vorab hatte die Global IP Matrix ausserdem in ihrer jüngsten Ausgabe 11 zur Einstimmung auf das Panel 31 eine Zusammenfassung von Dr. Augenstein zum aktuellen Stand des UPC veröffentlicht.

Aktuelle News
BGH: Laufradschnellspanner – Campagnolos Erbe
Der BGH hatte zu entscheiden, ob das Streitpatent gegenüber aus dem Stand der Technik bekannten Laufradschnellspannern aufgrund der besonderen Gestaltung eines Teils (des Hebels) neu und erfinderisch ist (BGH, Urteil vom 15.06.2021 (Az. X ZR 61/19) – Laufradschnellspanner).
1. DAS STREITPATENT
Das Streitpatent betrifft einen Laufradschnellspanner für Fahrräder. Dieser Laufradschnellspanner zeichnet sich dadurch aus, dass der Hebel in der axialen Richtung beweglich angeordnet ist. Dadurch ist der Hebel gegen die Vorspannung einer Vorspannfeder von einer Eingriffsstellung in eine Drehposition bewegbar. In der Eingriffsstellung überträgt der Drehhebel eine Klemmkraft. In der Drehposition ist die Winkeleinstellung des Hebels dagegen unabhängig von dem Spannungszustand des Schnellspanners einstellbar.
Damit grenzt sich das Streitpatent von dem zitierten Stand der Technik ab. Bekannt waren Schnellspannsysteme, bei denen die Klemmkraft durch Umlegen eines Exzenters aufgebracht wurde. Nachteilig an diesem System war aber, dass mit der Spannmutter zuerst die Klemmlänge eingestellt werden musste. Da die Klemmkraft erst durch Umlegen des Exzenters überprüft werden konnte, bedurfte es im Normalfall mehrere Versuche, bis der Anwender die passende Klemmlänge gefunden und eingestellt hatte (vgl. Abs. [0003] und [0004]). Darüber hinaus musste der Exzenter gelöst werden, um die Position des Hebels zu verändern (vgl. Abs. [0011]).
Das Streitpatent hat sich daher zur Aufgabe gemacht, einen Schnellspanner für Fahrräder bereitzustellen, welcher einfacher zu bedienen ist (vgl. Abs. [0005]). Vorteil der Erfindung sind, dass zum einen der Schnellspanner einfach bedient werden kann, indem die Klemmkraft des Schnellspanners durch das Spannstück und damit dem Hebel bestimmt wird, ohne, dass eine Vorspannung eingestellt werden muss. Zum anderen kann die Winkelposition des Hebels, unabhängig von der Spannkraft, frei gewählt werden (vgl. Abs. [0010]).
2. ENTGEGENHALTUNGEN
Der Neuheit des Streitpatents hat die Klägerin mehrere Druckschriften (K4, K5, K5a und K9) entgegengehalten. Diese haben gemeinsam, dass sie Spannvorrichtungen mit einem Hebel, nicht aber eine Verwendung zur Befestigung eines Laufrads an einem Fahrrad zeigen, obwohl die Spannvorrichtungen grundsätzlich dazu geeignet wären. Bekannt ist das in den Entgegenhaltungen gezeigte Funktionsprinzip zudem bereits seit mehreren Jahrzehnten.
Die Entgegenhaltungen K6 und K8 wurden als nächstliegender Stand der Technik zur Beurteilung der Erfindungshöhe diskutiert. In beiden Fällen werden Laufradschnellspanner offenbart, die ebenfalls keinen Exzenter aufweisen, sondern über den Hebel gespannt werden, ohne vorher eine Vorspannung einstellen zu müssen. Die K6 unterscheidet sich dahingehend von der K8, dass diese einen Hebel aufweist, welcher abnehmbar ist. Dies hat den Vorteil, dass die Laufräder besser gegen Diebstahl geschützt sind. Der Hebel der K8 hingegen war fest, mit dem Nachteil, dass dieser eine ungünstige Endposition einnehmen konnte. Die K6 und K8 offenbaren somit den anspruchsgemäßen Klemmhebel nicht.
Die Ausgestaltung des streitpatentgemäßen Klemmhebels war aber vor allem für Werkzeugmaschinen bereits seit Jahrzehnten bekannt. In Kombination offenbaren die bekannten Laufradschnellspanner und die aus anderen Bereichen bekannten Klemmhebel sämtliche Merkmale des Streitpatents.
3. ENTSCHEIDUNG BGH
Der BGH hat in Übereinstimmung mit dem Bundespatentgericht entschieden, dass das Streitpatent gegenüber den geltend gemachten Kombinationen neu und erfinderisch ist.
Das Streitpatent sei neu, weil die Entgegenhaltungen nicht unmittelbar und eindeutig eine Verwendung der Spannvorrichtungen für Laufräder von Fahrrädern offenbaren. Zudem sei das Streitpatent gegenüber dem nächstliegenden Stand der Technik (K6 und k8) erfinderisch. Vor dem Hintergrund, dass zum einen das Funktionsprinzip des Klemmhebels in anderen Bereichen und zum anderen die Vorrichtung des Schnellspanners bereits seit Jahrzehnten bekannt waren, bedurfte es einer zusätzlichen Anregung für den Fachmann den Klemmhebel im Zusammenhang mit Schnellspannern einzusetzen.
In seiner Begründung führt der BGH weiter aus, dass für den Fachmann bereits kein Anlass bestand, die K6 in die Richtung des Streitpatents weiterzuentwickeln, weil der Hebel bei der K6 abnehmbar war, sodass die zu lösenden Probleme nicht gegeben waren. Ausgehend von der K8 habe der Fachmann ebenfalls keine Anregung gehabt, den Klemmhebel als Lösung heranzuziehen.
4. EINORDNUNG
Die Entscheidung vermag im Ergebnis und in der Begründung zu überzeugen. Sie reiht sich in der bisherigen Rechtsprechung zur erfinderischen Tätigkeit ein.
Besonderheit in dem vorliegenden Fall war, dass das Funktionsprinzip zwar bereits seit mehreren Jahrzehnten bekannt war, allerdings nicht in den Vorrichtungen eingesetzt wurde, die ebenfalls bereits seit mehreren Jahrzehnten bekannt waren.
Zutreffend hat der BGH entschieden, dass der Umstand, dass das bekannte Funktionsprinzip nicht auf die streitpatentgemäßen Vorrichtungen übertragen wurde, dazu führt, dass der Fachmann aus dem Stand der Technik eine zusätzliche Anregung bedurfte, um das bekannte Funktionsprinzip in der bekannten Vorrichtung einzusetzen. Die Begründung steht im Einklang mit der Rechtsprechung des BGH, dass nach dem Einzelfall zu bestimmen ist, in welchem Umfang und mit welcher Konkretisierung der Fachmann Anregungen im Stand der Technik benötigt, um eine bekannte Lösung in bestimmter Weise weiter zu entwickeln (BGH GRUR 2014, 647, Rn. 25 – Farbversorgungssystem; BGH GRUR 2017, 498 – gestricktes Schuhoberteil).
Dies bedeutet aber nicht, dass aufgrund des langen Stillstands im Stand der Technik die Erfindung nicht nahegelegen haben kann. Vielmehr führt der Stilstand im Stand der Technik lediglich dazu, dass allein die sachliche Nähe zur erfindungsgemäßen Lehre nicht ausreicht, um die Erfindungshöhe zu verneinen, sondern der Fachmann einer zusätzlichen Anregung zur erfindungsgemäßen Lehre bedurfte. Dies folgt bereits aus dem Grundsatz, dass das Alter einer Entgegenhaltung nur eines von mehreren Kriterien darstellt (BGH GRUR 2017, 498, Rn. 29 – Gestricktes Schuhoberteil).
5. PRAXISHINWEISE
Diese Entscheidung zeigt mal wieder, dass es als Nichtigkeitskläger ratsam ist, möglichst umfassend zur Anregung der Weiterentwicklung einer Technologie vorzutragen. Ein Stillstand im Stand der Technik dürfte regelmäßig dazu führen, dass es einer weiteren Veranlassung für den Fachmann bedurfte und die alleinige Nähe zwischen dem nächstliegenden Stand der Technik und dem Streitpatent allein in solchen Fällen gerade nicht ausreichen dürfte. Hilfreich kann es im Einzelfall auch sein, einen möglichen Stillstand im Stand der Technik mit anderen (technikfernen) Motivationen zu erklären, sofern dafür Gründe vorlagen.
Carsten Plaga

Aktuelle News.
#GemEinsameSpitze: Als Mitglied der Big Band der Clara-Schumann-Musikschule Düsseldorf gewinnt Christof Augenstein den 10. Deutschen Orchesterwettbewerb 2021
Die Jury zeichnete die Big Band auch mit dem Sonderpreis für die hervorragende Interpretation zeitgenössischer Beethoven-Interpretationen aus. Pandemiebedingt fand in diesem Jahr der 10. Deutsche Orchesterwettbewerb (DOW) unter dem Motto „#VirtuellVirtuos“ größtenteils digital in ganz Deutschland statt.
Während eines Zeitraums von fünf Monaten nahmen an dem vom Deutschen Musikrat getragenen Wettberwerb insgesamt 55 Orchester in 15 Kategorien und mit einer beeindruckenden Größe von rund 3000 Musikerinnen und Musikern, teil. Sämtliche Formationen aus den 15 ausgeschriebenen Kategorien – darunter Kammer-, Sinfonie-, Akkordeon- und Blasorchester, Jugendorchester, Bläser- und Gitarrenensembles, Zupforchester sowie Big Bands – mussten sich zuvor auf Landesebene für den Start qualifizieren.
Was für die Juryarbeit gewöhnlich per Live-Aufführung stattfindet, musste in diesem Jahr aufwändig durch mobile Aufnahmenteams per Film begleitet werden. So fanden von Juni bis Ende Oktober Videoaufnahmen bei den Orchestern vor Ort statt. Abschliessend nahm im Dezember eine Jurys die Bewertungen für alle Kategorien vor. Die Ergebnisbekanntgabe erfolgte am 15.12.2021 per Livestram auf Youtube.
Zusätzlich wurden Sonderpreise für die hervorragende Interpretation einer zeitgenössischen Beethoven-Auftragskompositionen vergeben. Für das Pflichtwerk wurden in jeder Kategorie Kompositionsaufträge mit einem Bezug zu Beethovens Musik vergeben.
Wir freuen uns sehr, dass unser Partner Christof Augenstein, als Mitglied der Big Band der Clara-Schumann-Musikschule Düsseldorf und unter der Leitung von Romano Schubert nicht nur den Bundesorchesterwettbewerb für Big Bands selbst gewonnen, sondern auch den Sonderpreis für die hervorragende Interpretation der zeitgenössischen Beethoven-Auftragskomposition „A Birthday Song for Ludwig van“ von Mike Herting, erhalten hat.
Lieber Christof, herzlichen Glückwunsch zu dieser besonderen Auszeichnung!
Die vollständige Ergebnisbekanntgabe von Prof. Dieter Kreidler, Vorsitzender des Orchesterbeirats und Jurymitglied ist hier im Video abrufbar (time code, 20:30“).
Eine Videoaufnahme der musikalischen Interpretation und Darbietung des Gewinnerorchesters in der Kategorie E, Big Band erhalten Sie hier.
Der Deutsche Orchesterwettbewerb:
Der Deutsche Orchesterwettbewerb ist die zentrale Fördermaßnahme des Deutschen Musikrates für die Orchestermusik in Deutschland und richtet sich an Amateurorchester unterschiedlicher Besetzungen und Altersstufen. Der Leistungsvergleich und die Begegnung der Orchester geben den Musizierenden die Gelegenheit, ihr musikalisches Können und ihre künstlerische Ausdrucksfähigkeit zu präsentieren. Veranstaltet wird der Deutsche Orchesterwettbewerb alle vier Jahre vom Deutschen Musikrat. Er wird finanziell getragen von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Gemeinschaftliches Musizieren gilt als eine der beliebtesten Formen kultureller Freizeit-beschäftigungen und des bürgerschaftlichen Engagements. Mehr als vier Millionen Menschen musizieren und singen in ihrer Freizeit in Deutschlands Orchestern und Chören.
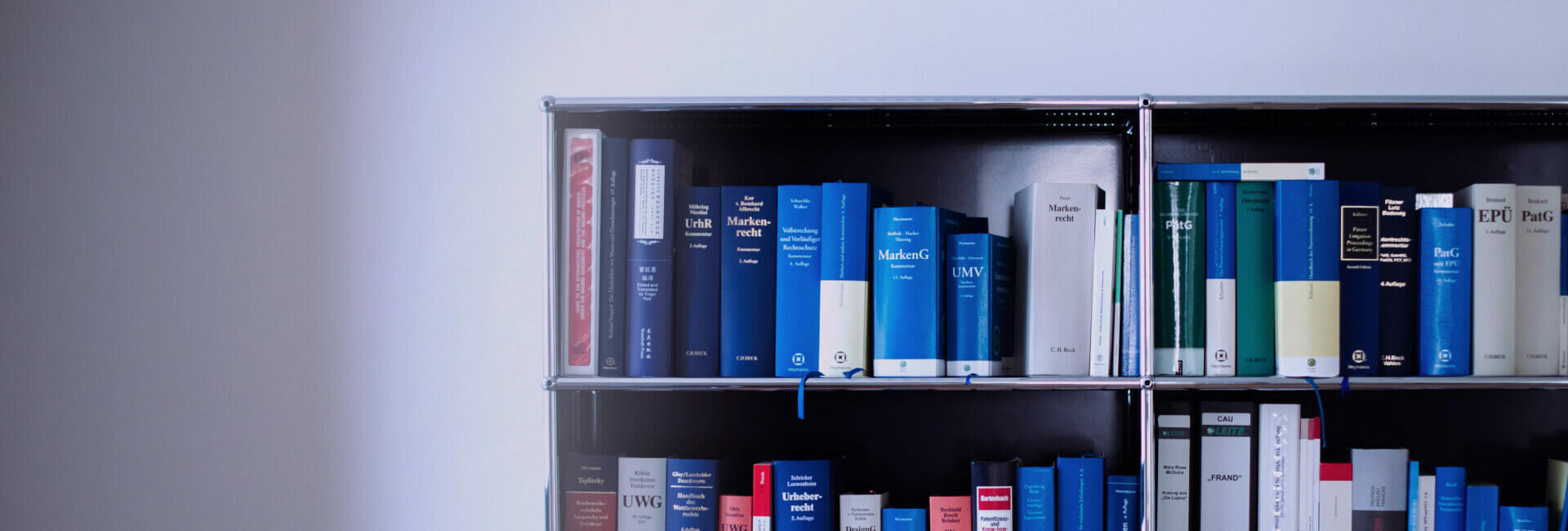
Aktuelle News.
Neue Buchveröffentlichung: Geistiges Eigentum als komplexes Anpassungssystem – die Rolle von IP in der Innovationsgesellschaft
Wir starten das neue Jahr mit dem Hinweis zu einer Buchveröffentlichung über „Geistiges Eigentum als komplexes Anpassungssystem – die Rolle von IP in der Innovationsgesellschaft“. In einem 19 Seiten umfassenden Buchbeitrag schreibt unser Partner Dr. Christof Augenstein im ersten von drei Teilen in Kapitel 3 über Technologieschutz und der Durchsetzung von Patenten in Europa, heute und in der Zukunft.
Das vorliegende Arbeitspapier unterstreicht die Bedeutung des Patentschutzes für technische Erfindungen im Vergleich zum ausschließlichen Schutz durch Geschäftsgeheimnisse. Der Patentschutz erfordert auch ein System der Durchsetzung, das den Bedürfnissen der Nutzer gerecht wird. Nach einem Überblick über den Status quo wird die Struktur des künftigen Einheitlichen Patentgerichts zusammengefasst. Ferner wird erörtert, ob Patentstreitigkeiten weiter vom Ort der Geschäftstätigkeit entfernt sein werden und ob die Streitigkeiten im Vergleich zur gegenwärtigen Situation umfangreicher und aufwändiger sein werden.
„Intellectual Property as a Complex Adaptive System – the role of IP in the innovation society“ erweitert die Buchreihe unter der Schirmherrschaft des Netzwerkes der europäischen Institute für geistiges Eigentum (European Intellectual Property Institutes Network, EIPIN) um ein weiteres prägnantes Werk.
Es erörtert die jüngsten Innovationstrends und legt den Schwerpunkt darauf, wie verschiedene Formen des Rechts des geistigen Eigentums diese Trends unterstützen können. Erfinder und Unternehmer werden durch den Lebenszyklus von IP-intensiven Vermögenswerten geführt, die die menschliche Kreativität kommerzialisieren. Unter Verwendung einer Reihe von sektorspezifischen, interdisziplinären und akteursorientierten Ansätzen bietet jeder Beitrag Vorschläge, wie Europas Fähigkeit zur Förderung eines innovationsbasierten, nachhaltigen Wirtschaftswachstums im globalen Maßstab verbessert werden kann.
Die insgesamt 232 Seiten umfassende Buchveröffentlichung wurde von Anselm Kamperman Sanders, Professor für Recht des geistigen Eigentums, Fachbereich Internationales und Europäisches Recht, und Anke Moerland, Professorin für Recht des geistigen Eigentums, Fachbereich Internationales und Europäisches Recht, Universität Maastricht, Niederlande am 7. Dezember 2021 herausgegeben. Einen ersten Einblick erhalten Sie hier.

Aktuelle News.
The Legal 500 Deutschland 2022 – Große Ehrung für Kather Augenstein
The Legal 500 wird seit 35 Jahren veröffentlicht und hat sich europa- und weltweit als eines der wichtigsten juristischen Handbücher etabliert. Kanzleien sowie Anwälte und Anwältinnen, die innerhalb ihres Rechtsbereiches hervorstechen und zu den Besten ihres Fachs gehören, werden ausgezeichnet und empfohlen.
In seinem diesjährigen Deutschland-Ranking hat The Legal 500 Kather Augenstein gleich mehrfach im Bereich „Patentrecht – Streitbeilegung“ besonders hervorgehoben und wiederholt in Tier 2 bestätigt. Wir freuen uns sehr über das hervorragende Ergebnis und die hohe Anerkennung, die unsere Kanzlei seit Jahren genießt.
Die Redaktion zählt Kather Augenstein „zu den größten Patentrechtsteams unter den deutschen IP-Boutiquen“, welches „seit Jahren einige der umfangreichsten Verfahren in Deutschland“ in „einem breiten Spektrum von Sektoren“ betreut. Neben Managing Partner Miriam Kiefer LL.M führt Legal 500 alle Partner unserer Kanzlei in seinem redaktionellen Teil als empfohlene Anwälte bzw. in der Kategorie Führende Namen.
In diesem Jahr freuen wir uns besonders darüber, dass unser Senior Partner Dr. Peter Kather in die Kategorie Hall of Fame und unser Partner Christopher Weber in die Kategorie Führende Namen aufgestiegen sind. Marktteilnehmer sagen über uns: „Peter Kather ragt durch seine große Erfahrung und ruhige Verhandlungsführung heraus“. Christoper Weber verfügt über ein „fantastisches technisches Wissen, das er mit einem Sinn für Humor kombiniert“, ihm werden weiterhin seine „effektive und sehr effiziente Arbeitsweise und seine sehr schnelle technische Auffassungsgabe“ mehrfach bestätigt.
Weiter freuen wir uns über die positiven Empfehlungen unserer Gründungspartner: Dr. Christof Augenstein „ist sehr mandantenorientiert und proaktiv. Er hat auch bei komplexen Fallgestaltungen einen umfassenden Überblick von sowohl rechtlicher als auch technischer Seite.“
Miriam Kiefer „ist eine ausgezeichnete Anwältin, die in technisch-juristisch komplexen Patentverfahren sehr zu empfehlen ist.“
Das vollständige Ranking für Deutschland ist ab sofort online und kann hier vollständig eingesehen werden.

Aktuelle News.
COVID-19: Warum wir keine Freigabe von Patenten auf Impfstoffe brauchen
National und international gibt es Instrumente, um notwendige Technologien rechtlich zur Verfügung stellen zu können, wie beispielsweise die Zwangslizenz. Eine Suspendierung des Patentschutzes erhöht die Verfügbarkeit von Impfstoff gerade nicht.
Mittlerweile kann man wohl sagen, dass alle Personen in Deutschland, die wollen, inzwischen gegen COVID19 geimpft sind. Die deutsche Impfquote liegt weit über dem Weltdurchschnitt. Vor allem in den Entwicklungs- und Schwellenländern ist von solchen Zahlen derzeit nur zu träumen.
Aufgrund dieser Ungleichverteilung werden zunehmend die Rufe nach einer Auflockerung bis hin zu einer Aussetzung des Patentschutzes für die Impfstoffe lauter. Nicht zuletzt der amerikanische Präsident Joe Biden verkündete, dass angesichts dieser „Menschheitskatastrophe“ eine zeitweise Freigabe von Impfstoffpatenten erfolgen müsse. Indien und Südafrika haben bereits die Aussetzung des TRIPS-Abkommens für COVID-19-Impfstoffe verlangt. Dies würde bedeuten, dass der Patentschutz weltweit entfiele und zudem keinerlei Lizenzgebühren gezahlt werden müssten. Die Diskussion schien abgeschlossen. Die ehemalige Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel hatte in ihrer letzten Regierungserklärung am 24.06.2021 noch einmal ihre ablehnende Haltung artikuliert. Sie bestätigte ausdrücklich, dass sie eine politisch erwirkte Freigabe der Patente für den falschen Weg halte. Die Produktion müsse auf Basis von Lizenzen vergrößert werden. Die Bundeskanzlerin argumentierte, dass die Welt auch in Zukunft darauf angewiesen sei, dass Impfstoffe entwickelt werden. Dies könne nur gelingen, wenn der Schutz geistigen Eigentums nicht außer Kraft gesetzt werde.
Gleichzeitig scheint der Druck nun abgenommen zu haben, nachdem die Europäische Union zusammen mit den Impfstoffherstellerinnen umfangreiche Zusagen für die Lieferung von Impfstoff gegeben hat. Doch immer wieder flammen Stimmen auf, die Patente suspendieren wollen, um den Impfstoff dadurch angeblich global verfügbarer zu machen. Zuletzt forderten beispielsweise prominente Redner und Rednerinnen der Linkspartei bei der Diskussion der Impfpflicht im deutschen Bundestag, Patente auf Impfstoffe freizugeben. Die aktuelle Forderung der Linkspartei sehen sie hier.
Der hinter all diesen Forderungen stehende Wille, allen Menschen einen Zugang zu Impfstoff zu ermöglichen, ist essenziell und muss selbstverständlich sein. Um dies zu erreichen, muss allerdings der richtige – oder jedenfalls ein effektiver – Weg gewählt werden. Dabei müssen wir auch einen Blick in die Zukunft werfen. Patente dienen letztlich auch dem Ansporn zu Forschung und Innovation. Diese Innovationskraft könnte mit Blick auf zukünftige Pandemien in ganz entscheidender Weise eingeschränkt werden, wenn wir nun das Vertrauen der Unternehmen und Investoren in ihr geistiges Eigentum erschüttern.
Es ist überaus fraglich, ob eine Aufhebung des Patentschutzes überhaupt das gewünschte Ziel erreichen kann. Kann der Mangel an Impfdosen dadurch beseitigt werden, Unternehmen auf der ganzen Welt das Rezept für einen Impfstoff in die Hand zu drücken? Haben wir nicht, selbst im kleinen Kreis der derzeitigen Impfstoffherstellerinnen, gesehen, dass nicht das technische Know-How die Massenproduktion hindert? Problematisch ist doch der Mangel an Produktionswerkstätten, Material und Fachpersonal. Es kann eben nicht jedes Unternehmen von heute auf morgen einen Impfstoff herstellen, wenn es denn nur das Rezept in Händen hält. So kann bereits die Einrichtung einer einzelnen Anlage mehrere Monate dauern. Zudem enthält eine Patentschrift nicht jegliches Know-How, das tatsächlich erforderlich ist, um das Produkt herzustellen. Wollte man so weit gehen und auch den Schutz von Know-How aufheben, müsste man sich dann doch fragen lassen, wie man gedenkt faktisch an dieses Wissen heranzukommen. Vor diesem Hintergrund ist zweifelhaft, ob die Aufhebung des Patentschutzes für die aktuelle Pandemie überhaupt Wirkung entfalten könnte.
Den Patentschutz aufzuheben ist damit keine Lösung. Dies würde massiv in die Rechte der Unternehmen eingreifen und kann gleichzeitig die Verfügbarkeit nicht erhöhen (man möge sich zudem vorstellen, wie die zukünftige Reaktion der Unternehmen wäre: keine Forschung oder keine Veröffentlichung der Forschungsergebnisse und damit gar kein Wissenszugang).
Zudem erstaunt es doch sehr, wie schnell bei geistigem Eigentum Letzteres entwertet wird. Sprechen wir über die Impfdosen selbst und nicht über die Technik dahinter, findet die Diskussion abrupt ein Ende. So ist es einhellige Meinung, dass Impfdosen, die bspw. die USA an andere Länder spenden, vorher bezahlt wurden. Hier gibt es bisher keine Aufrufe, die Impfstoffherstellerinnen dazu zu zwingen, die Impfdosen kostenlos abzugeben. Ebenso gibt es bisher keine Bestrebungen die Lagerhallen von z.B. BioNTech, Pfizer oder Moderna zu plündern. Sobald das Wissen in einem Fläschchen verkörpert ist, ist es ja auch „richtiges Eigentum“. Wir haben uns allerdings dazu entschieden nicht nur dingliches, sondern eben auch geistiges Eigentum zu schützen.
Dabei kennt das deutsche Recht sogar die Möglichkeit, den Patentschutz teilweise auszusetzen. Das Infektionsschutzgesetz gewährt die Möglichkeit, auf das rechtliche Eigentum der Impfstoffherstellerinnen zuzugreifen. § 13 des Patentgesetzes gewährt der Bundesregierung die Möglichkeit, den absolut wirkenden Patentschutz teilweise per Anordnung auszusetzen. Konkret bedeutet dies, dass sie den Patentschutz insoweit lockern könnte, als dass die patentierte Technologie – also die Bauanleitung des COVID-19-Impfstoffs – auch ohne die Zustimmung der Rechteinhaber und Rechteinhaberinnen von der Bundesregierung selbst oder von Dritten (u.a. auch impfstoffherstellende private Unternehmen) verwendet werden kann. Entscheidend hierbei ist allerdings, dass nach § 13 Abs. 3 PatG ein Anspruch auf angemessene Vergütung gegen den Bund besteht.
Neben den Stimmen, die den Patentschutz aufheben möchten, wächst die Anzahl der Stimmen, die die Vergabe von Zwangslizenzen fordern.
Auch diese Möglichkeit hat der deutsche Gesetzgeber bereits vorgesehen in § 24 PatG. Hiernach haben private Unternehmen die Möglichkeit, im Rahmen eines nichtausschließlichen Nutzungsrechts, von der patentierten Erfindung auch gewerblichen Gebrauch zu machen. Voraussetzung für die Erteilung einer Zwangslizenz ist zunächst, dass sich Lizenzsuchende innerhalb eines angemessenen Zeitraums erfolglos bemüht haben, die Zustimmung des Patentinhabers oder der Patentinhaberin zur gewerblichen Nutzung zu erhalten. Darüber hinaus muss die Erteilung einer Zwangslizenz auch im öffentlichen Interesse liegen.
Mit Blick auf medizinische Aspekte hat der Bundesgerichtshof in einer Entscheidung aus dem Jahr 2017 festgestellt, dass ein solches öffentliches Interesse bei der Verteilung eines HIV-Medikaments besteht (BGH, 11.07.2017 – X ZB 2/17).
Wird eine Zwangslizenz vergeben, so beschränkt das Gericht den Umfang und die Dauer auf ein Maß, das der Umsetzung des öffentlichen Interesses gerecht wird. Außerdem haben die Patentinhaber und Patentinhaberinnen einen Anspruch auf eine angemessene Vergütung.
Das deutsche Patentrecht stellt damit schon alle erforderlichen Instrumente zur Verfügung, um bei öffentlichem Interesse, auf das geistige Eigentum einzuwirken. Der entscheidende Unterschied zu den Bemühungen Indiens, Südafrikas und den USA ist dabei, dass den Patentinhabenden eine angemessene Vergütung zusteht. Dass es sich bei den Impfstoffen gegen COVID-19 um Güter handelt, die zum Wohle der Menschheit für alle Menschen zugänglich sein müssen, ist evident. Umso wichtiger ist es jetzt, auch für die Zukunft, einen Weg zu finden, der die Interessen der Beteiligten in Einklang bringt. Es muss weiterhin für die Unternehmen lukrativ sein, in die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen zu investieren. Gleichzeitig müssen die entsprechenden Forschungsergebnisse allen Menschen zugänglich sein.
Den Patentschutz aufzuheben, löst nicht das Problem der Ungleichverteilung von Impfstoff auf der Welt. Dieser Vorschlag beruht am Ende auch nicht wirklich auf dem Willen, die Verfügbarkeit der Impfstoffe zu erhöhen. Die Idee dahinter ist es vielmehr, etwaige Lizenzgebühren zu sparen.
Dr. Christof Augenstein
Dr. Katharina Brandt
