
Aktuelle News.
Besondere Auszeichnung – Kather Augenstein gewinnt Impact Case of the Year Award anlässlich der Managing IP EMEA Awards 2023
Kather Augenstein hat bei den 18. Managing IP EMEA Awards 2023, die am 21. Juni in London stattfanden, mit dem „Impact Case of the Year – Heitec v Heitech Promotion“ eine besondere Auszeichnung erhalten. Unsere IP Boutique zählte damit zu den renommierten europäischen IP- und Anwaltskanzleien, die am gestrigen Abend im Rahmen der feierlichen Preisverleihung geehrt wurden.
Mit den EMEA Awards werden jedes Jahr diejenigen Inhouse-Teams, Kanzleien, Rechtsanwälte und Unternehmen gewürdigt, die für die innovativste und anspruchsvollste Arbeit im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes im vergangenen Jahr maßgeblich verantwortlich sind, sowie diejenigen, die den internationalen Markt vorantreiben.

Dr. Christof Augenstein kommentiert den Preisgewinn wie folgt: „Wir freuen uns sehr, dass wir bei den Managing IP EMEA Awards 2023 in der Markenrechtsstreitigkeit von Heitec vs. Heitech Promotion als einer der Gewinner der European Impact Cases of the Year geehrt wurden. Ich war persönlich von Anfang an in diesen Rechtsstreit involviert, den wir nach mehreren Instanzen vor dem BGH und EUGH zu Beginn diesen Jahres nach fast neun Jahren erfolgreich zu Ende bringen konnten. Es ist eine große Ehre, dass unsere Arbeit anerkannt wurde.“
Detaillierte Hintergrundinformationen zum Fallverlauf finden Sie in unserem News- und Blogbereich.
Eine vollständige Liste der Preisträger finden Sie hier.

Aktuelle News.
Leaders League Rankings 2023: Kather Augenstein als eine der führenden Rechtsanwaltskanzleien für Patent- und Markenstreitigkeiten ausgezeichnet
Wir freuen uns, in den diesjährigen Leaders League Rankings 2023 erneut als eine der führenden Rechtsanwaltskanzleien für gewerblichen Rechtsschutz für Patent- und Markenstreitigkeiten ausgezeichnet worden zu sein.
Dabei wurde das Team von Kather Augenstein in der neuen Leaders League Rangliste in der Kategorie Patentstreitigkeiten mit dem Prädikat „ausgezeichnet“ eingestuft und darüber hinaus im Bereich Markenrechtsstreitigkeiten mit dem Prädikat „sehr empfehlenswert“ bewertet.
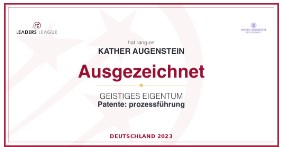

Wir gratulieren unseren Partnern Dr. Peter Kather, Dr. Christof Augenstein, Miriam Kiefer LL.M., Christopher Weber und Sören Dahm sowie dem gesamten Team für diese besondere Auszeichnung.
Leaders League ist eine Medien- und Rating-Agentur für Top-Führungskräfte auf internationaler Ebene, die regelmäßig internationale Rankings und Nachrichteninhalte für die Rechts-, Finanz-, Technologie- und Personalbranche erstellt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kanzleirankings und Marktforschung, die von einer Vielzahl von Unternehmen und Führungskräften bei ihren Entscheidungen verwendet werden. Alle Rankings stehen auf Leaders League zur Verfügung.

Aktuelle News.
#wirfahrenmit: Klimafreundlich und gesundheitsfördernd unterwegs mit dem Dienstrad
Wir sind sehr stolz, dass eine Vielzahl unserer Mitarbeiter von unserem digitalen Dienstrad-Programm mit @DeutscheDienstrad profitieren. Damit ergänzen wir unser facettenreiches Portfolio an Mitarbeiter-Benefits um einen weiteren wichtigen Baustein und fördern zugleich die Gesundheit unseres Teams.
Mit dem Dienstrad-Angebot bieten wir unseren Mitarbeitern einen erschwinglichen und klimaneutralen Zugang zur nachhaltigen Mobilität. Durch die freie Marken-, Modell- und Herstellerauswahl bleiben keine Wünsche offen und jeder hat die Möglichkeit sein Traumrad individuell zu gestalten.
Mit dem MobilityHub der Deutsche Dienstrad entscheidet parallel jeder Mitarbeiter selbst, wo und wie er sein Dienstrad wählt und empfängt. Gemeinsam leisten wir damit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz und wirken positiv auf die CO2 Bilanz unserer Welt ein, beruflich wie privat.
Wir bewegen Deutschland mit unserem Team bei @KatherAugenstein.


Aktuelle News.
Zum heutigen Startschuss des Einheitlichen Patentgerichts (UPC): Christof Augenstein im Podcast-Interview mit Emily O’Neill von Deminor Litigation Funding
In einer laufenden Podcast-Reihe führt Emily O’Neill, General Counsel UK und Global Intellectual Property Lead bei Deminor Litigation Funding, Interviews mit globalen Experten, um die Auswirkungen des neuen Einheitlichen Patentgerichts (UPC) zu verstehen.
In seinem jüngsten Interview gibt unser Dr. Partner Christof Augenstein wertvolle Einblicke in das bevorstehende Einheitliche Patentgericht (UPC), erörtert dessen allgemeine Bedeutung und skizziert seine Prognosen für die ersten Tage des neuen Systems und darüber hinaus.
Das vollständige Podcast-Interview finden Sie hier
Deminor ist der Markenname der Deminor Recovery Services Gruppe, die Unternehmen und Anleger bei der Durchsetzung von Rechtsansprüchen unterstützt.
Deminor ist ein Pionier auf seinem Gebiet und hat eine führende Rolle bei zahlreichen entscheidenden Anlegerklagen auf der ganzen Welt gespielt. Die Gruppe ist in 15 Jurisdiktionen aktiv und hat sieben Büros in Europa, Großbritannien, den USA und Asien.

Aktuelle News.
Neuigkeiten im Fall des Paprika-Patents
Grundnahrungsmittel wie Obst und Gemüse werden schon seit Tausenden von Jahren angebaut und verzehrt. Mittlerweile gibt es jedoch auch dabei rechtliche, insbesondere patentrechtliche, Vorgaben zu beachten. Das Europäische Patentamt entfacht durch seine neuste Entscheidung im Fall des Paprika-Patents nun erneut die Debatte um ethische und rechtliche Aspekte des Patentrechts in der Landwirtschaft. Doch was hat es mit dem Paprika-Patent auf sich und wieso ist es so umstritten?
Im Jahr 2013 genehmigte das Europäische Patentamt (EPA) für den Konzern Syngenta ein Patent auf eine insektenresistente Paprikapflanze (EP2140023). Die Insektenresistenz der Paprikapflanze ergab sich aus der Kreuzung einer wilden Paprikapflanze aus Jamaika mit einer kommerziellen Paprikapflanze und einer anschließenden Selektion der gemeinsamen Nachkommen. Kenntnis von der Resistenz erlangte der Konzern durch eine frei zugängliche Datenbank. Das erteilte Patent umfasst die Paprikapflanzen selbst, deren Verwendung, deren Früchte, ihr Saatgut und alle Züchtungsschritte. Damit wurde von Syngenta sowohl der Anbau als auch die Ernte der Pflanzen für sich beansprucht.
Im Jahr 2013 genehmigte das Europäische Patentamt (EPA) für den Konzern Syngenta ein Patent auf eine insektenresistente Paprikapflanze (EP2140023). Die Insektenresistenz der Paprikapflanze ergab sich aus der Kreuzung einer wilden Paprikapflanze aus Jamaika mit einer kommerziellen Paprikapflanze und einer anschließenden Selektion der gemeinsamen Nachkommen. Kenntnis von der Resistenz erlangte der Konzern durch eine frei zugängliche Datenbank. Das erteilte Patent umfasst die Paprikapflanzen selbst, deren Verwendung, deren Früchte, ihr Saatgut und alle Züchtungsschritte. Damit wurde von Syngenta sowohl der Anbau als auch die Ernte der Pflanzen für sich beansprucht.
Im Februar 2023 wurde das Patent nun erneut von der EPA bestätigt und das, obwohl ein solches Patent nach aktueller Rechtsprechung eigentlich nicht mehr zulässig ist. Seit 2017 dürfen für Pflanzensorten, die durch natürliche Methoden wie Kreuzung und Selektion entstanden sind, keine Patente ausgesprochen werden. Patentrechtsfähig sind demnach nur noch Pflanzensorten, die gentechnisch erzeugt wurden. Dabei wird die Gentechnologie patentiert, die genetische Vielfalt und das Saatgut jedoch nicht. Der Konzern Syngenta beantragte das Paprika-Patent jedoch bereits im Jahr 2008 und damit weit vor der neuen Rechtsprechung.
Nichtsdestotrotz sorgt auch die aktuelle Rechtsprechung weiterhin für Unklarheit, denn auch gentechnisch erzeugte Pflanzen können in vielen Fällen genauso auch durch die klassische Kreuzung mit anschließender Selektion entstehen. Ob die gentechnisch erzeugten Pflanzen in diesen Fällen trotzdem patentiert werden dürfen, ist derzeit strittig. Ob und inwieweit sich das Patentrecht in der Landwirtschaft weiter entwickelt, wird sich an zukünftigen Patentrechtsentscheidungen zeigen.

Aktuelle News.
Hat PayPal zu viel Marktmacht? Bundeskartellamt leitet Verfahren ein
Jeder kennt die Zahlungsoption „Paypal“. Für den Verbraucher scheint sie unkompliziert, sicher und vor allem kostenlos zu sein. Das gilt aber nicht für die Verkäufer. Denn wenn der Käufer die Zahlungsmethode Paypal wählt, fallen Gebühren an. Das ist unproblematisch. Auch andere Anbieter berechnen Gebühren. Problematisch könnten allerdings die Nutzungsbedingungen von Paypal sein. Genau diese Nutzungsbedingungen sind nun Gegenstand eines Verfahrens des Bundeskartellamts. Denn dieses befürchtet, Paypal hätte auf Grund der eigenen Nutzungsbedingungen zu viel Marktmacht. Daraus könnte die Behinderung von Wettbewerbern sowie die Beschränkung des Preiswettbewerbs resultieren.
Wenn andere Zahlungsmethoden für den Verkäufer günstiger sind, liegt es nahe, dass er sie bevorzugt. Theoretisch ist es möglich, den Käufer bei der Wahl der Zahlungsmethode zu beeinflussen. Doch genau das schließen die Nutzungsbedingungen von Paypal in Deutschland aus. Hier sind „Regeln zu Aufschlägen“ und zur „Darstellung von Paypal“ geregelt. Danach dürfen die Verkäufer ihre Waren bei der Wahl einer anderen Zahlungsmethode als Paypal nicht günstiger anbieten. Außerdem dürfen die Verkäufer danach auch nicht auf die durch Paypal anfallenden Gebühren hinweisen oder die Käufer anderweitig bei der Wahl der Zahlungsoption beeinflussen. Möglich wäre das beispielsweise durch das Angebot eines schnelleren und komfortableren Vertragsabschlusses. Genau diese Regeln in den Nutzungsbedingungen haben das Bundeskartellamt stutzig gemacht.
Das Verfahren des Bundeskartellamts findet seine Grundlage in Art. 102 AEUV und § 19 GWB. Danach gilt ein kartellrechtliches Verbot des Missbrauchs einer marktbeherrschenden bzw. nach § 20 GWB, einer marktmächtigen Stellung. Außerdem komme, dem Bundeskartellamt nach, ein Verstoß gegen das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen nach Art. 101 AEUV und § 1 GWB in Betracht. Das Bundeskartellamt werde eigener Aussage nach prüfen, welche Marktmacht Paypal zukommt. Außerdem soll geklärt werden, inwiefern Verkäufer auf Online-Plattformen darauf angewiesen sind, Paypal als Zahlungsmethode anzubieten.
Denn wenn die Händler gehindert werden, die unterschiedlichen Kosten, die durch die Wahl einer Zahlungsmethode entstehen, zu berücksichtigen und an den Endkunden weiterzugeben, könnte es problematisch werden. In dem Fall können sich andere Zahlungsmethoden im Wettbewerb nur schwer oder gar nicht behaupten und durchsetzen. Das führt dazu, dass die marktmächtigen Zahlungsdienste noch höhere Preise für ihre Dienstleistung verlangen könnten.
Am Ende wären es die Verbraucher, die diese Situation ausbaden dürfen. Denn die Kosten für die Zahlungsmethode lässt kein Händler in seiner Preisberechnung aus, auch wenn diese im Gegensatz zu Versandkosten auf der Abrechnung nicht sichtbar werden. Wenn sich kein günstigerer Zahlungsdienstleister durchsetzt oder die Preise gar erhöht werden, verbleiben die Kosten für die Zahlungsoption in der Kalkulation der Verkäufer. Und diese trägt schlicht der Käufer. Derzeit betragen die Kosten zwischen 2,49 und 2,99 Prozent des zu zahlenden Betrages sowie zusätzlich 34 bis 39 Cent pro Transaktion. Marktstudien nach ist Paypal auf dem deutschen Markt damit einer der teuersten Online-Zahlungsdienste. Ob das Bundeskartellamt am Ende von dem Verfahren auch anderen, günstigeren Zahlungsdienstleistern die Möglichkeit eröffnen wird, sich am Markt durchzusetzen, bleibt abzuwarten.

Aktuelle News.
Managing IP Stars 2023: Miriam Kiefer unter den Top 250 Frauen in IP
Herzlichen Glückwunsch an unsere Managing Partnerin Miriam Kiefer LL.M., die zum vierten Mal in Folge als führende IP-Anwältin im internationalen Verzeichnis der „Top 250 Women in IP“ von Managing IP in der IP Stars 2023-Rangliste ausgezeichnet wurde.
Gewürdigt werden erfahrene Rechtsanwältinnen und IP-Expertinnen aus dem Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes, die im vergangenen Jahr außergewöhnliche Leistungen für ihre Mandanten und Unternehmen erbracht haben.
Die diesjährige Referenzliste umfasst mehr als 30 Rechtsgebiete weltweit, weitere Informationen sowie Zugang zum vollständigen Ranking erhalten Sie hier.

Aktuelle News.
The Legal 500 Deutschland Ranking 2023: Kather Augenstein erneut als eine der führenden Kanzleien für Patentstreitigkeiten ausgezeichnet
Zum wiederholten Mal wurde Kather Augenstein von The Legal 500 Deutschland als „Führende Kanzlei“ und als führend im Bereich „Gewerblicher Rechtsschutz -Patentstreitigkeiten“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt jährlich weltweit Kanzleien und einzelne Anwälte für ihre herausragenden Leistungen, basierend auf dem Feedback von Mandanten, Peers und Mitstreitern.
Einige dieser beschreiben uns als „höchstqualifiziertes Team, das leise, kompetent und fokussiert Fälle in einer menschlich sehr angenehmen Art bearbeitet“, sowie als ein „sehr schlagkräftiges und effizientes Team, sowohl bei kleineren als auch größeren Fällen.“
Miriam Kiefer wird eine „vertrauensvolle, menschlich sehr angenehme, enge und sehr gut abgestimmte Zusammenarbeit in einer Zahl von Verletzungsfällen, Gutachten und SPC-Verfahren“ bestätigt.
Zu den zahlenmäßig stärksten IP-Boutiquen in Deutschland gehört laut Redaktion von The Legal 500 das Team von Kather Augenstein Rechtsanwälte in Düsseldorf, dessen breites Beratungsportfolio sich im patentrechtlichen Kontext in den einzelnen Schwerpunkten der zentralen Kontakte widerspiegelt.
So ist Partner Dr. Christof Augenstein vermehrt in den Bereichen Elektronik, Telekommunikation, Medizin und Automotive aktiv, während Senior Partner Dr. Peter Kather starke Akzente bei grenzüberschreitenden Verfahren setzt. Die in der Medizintechnik versierte Managing Partner Miriam Kiefer leitet das Experten Team, zu dem auch die beiden Partner Christopher Weber (unter anderem mit Schwerpunkt in den Bereichen Software, Elektronik, Pharma, Chemie, Mechanik und Kunststoffverarbeitung) und der in technologienahen, oftmals grenzüberschreitenden Sachverhalten versierte Sören Dahm gehören. Zum Kernteam gehört auch Dr. Benjamin Pesch und seinem Schwerpunkt auf computerimplementierte Erfindungen, der im Juli 2022 zum Counsel ernannt wurde.
Wie bereits im vergangenen Jahr freuen wir uns besonders darüber, dass unser Senior Partner Dr. Peter Kather erneut in die Kategorie Hall of Fame aufgenommen wurde und darüber, dass unsere Partner Christof Augenstein und Christopher Weber zum wiederholten Mal als Führende Namen ausgezeichnet werden.
Über The Legal 500
The Legal 500 wird seit 36 Jahren veröffentlicht und ist weitgehend als das weltweit umfassendste juristische Handbuch anerkannt. Über 300.000 Inhouse-Juristen und -Juristinnen weltweit werden jedes Jahr von uns befragt und interviewt.

Aktuelle News.
Adidas und die Streifen
Für seine markenrechtlichen Klagen ist Adidas längst bekannt. Der deutsche Sportriese ist bei den Designs der Konkurrenz stets auf der Hut. Im Januar wurde erneut ein spannendes Urteil zu den berühmten drei Streifen gefällt.
Der Sachverhalt reicht bis ins Jahr 2007 zurück. Zu dieser Zeit beschwerte sich Adidas über das Drei-Streifen-Design von Thom Browne. Dieser zeigte sich verständnisvoll und wechselte zum Vier-Streifen-Design. Einige Jahre später steht fest: Das reichte dem deutschen Sportartikelhersteller nicht. Die Unzufriedenheit spitze sich aber erst zu, als Thom Browne anfing, große Erfolge zu verzeichnen und sich im Sportbekleidungsgeschäft zu etablieren. Im Juni 2021 klagte Adidas gegen Thom Browne mit dem Ziel, ihm das Verwenden von Streifen zu untersagen und eine Zahlung von mehr als 7,8 Millionen Dollar zu erreichen. Im Januar 2023 erging nun das Urteil.
Der Vorwurf von Adidas: Das Design von Thom Browne sei dem markeneigenen Drei-Streifen-Design zu ähnlich und stelle daher eine Verletzung der eigenen Markenrechte dar. Tatsächlich verwendet Tom Browne bei seinen Kreationen in der Regel vier Streifen, die ein Kleidungsstück umschließen. Die Streifen umranden beispielsweise Socken. Solche trug der Designer demonstrativ auch zur Gerichtsverhandlung. Der vier Streifen bediene sich Thom Browne der Argumentation von Adidas nach, um auf die von ihm entworfene Sportkleidung aufmerksam zu machen. Somit nutze er die Bekanntheit von Adidas aus. Daraus seien Kooperationen mit Sportlern entstanden, wie die mit Lionel Messi. Dieser sei zuvor Adidas-Botschafter gewesen. Thom Browne wehrte sich insbesondere mit dem Argument, dass Streifen ein gängiges Designelement für Bekleidung seien. Außerdem bediene er den Luxuswarenmarkt, sodass zwischen den beiden Unternehmen keine direkten Konkurrenz bestünde.
Die Geschworenen kamen zu dem Ergebnis: Adidas könne nicht beweisen, dass Thom Browne die Marke des Sportriesen verletzt habe. Als Grund wird hierfür die unterschiedliche Anzahl an Streifen angeführt – Vier statt drei Streifen, das schließe eine Verwechslungsgefahr aus.
Vorhersehbar war dieses Ergebnis nicht. Die Rechtsprechung, die sich bereits oft mit den drei Streifen beschäftigt hat, entscheidet je nach Einzelfall. Im Jahr 2016 bejahte der EuGH eine Verwechslungsgefahr bei einer Marke, die zwei statt drei Streifen verwendete. Im Jahr 2019 entschied der EuG jedoch, bei derselben Gegenpartei, dass die drei Streifen zu Recht als Unionsmarke aus dem Register gelöscht wurde. Es mag zwar zunächst verwundern, dass die Urteile in auf den ersten Blick gleichen Sache anders ausfallen. Der kleine aber feine Unterschied lag laut Gericht in der Anordnung der Streifen, also der Design-Entscheidung.
Die erste Rechtssache bezog sich auf drei schräge Streifen auf Turnschuhen. Hier erkannte das Gericht eine Verwechslungsgefahr für Verbraucher an, denn Adidas benutze markentypisch schräge Streifen, gerade auf Turnschuhen ein ikonischer Wiedererkennungswert. In der zweiten Sache ging es um drei senkrechte schwarze Streifen auf weißem Hintergrund. Dies verbinde der Verbraucher dem Gericht nach nicht notwendigerweise mit Adidas. Es handle sich dabei um ein schlicht dekoratives Element, das mit keiner Marke verbunden werde. Das Gegenteil konnte Adidas dem Gericht nach nicht beweisen.
Adidas zeigt sich nach dem Erlass des aktuellen Urteils sehr enttäuscht und deutet an, nicht vor Rechtsmitteln zurückzuscheuen. An der Verteidigung des eigenen geistigen Eigentums liegt dem Unternehmen viel. Vergangene Entscheidungen zeigen, auf welche Feinheiten es ankommen kann.

Aktuelle News.
Heitec vs. Heitech III – Kather Augenstein erstreitet Leitentscheidung im Markenrecht vor dem BGH
In dem Markenrechtsstreit zwischen der HEITEC AG und der HEITECH Promotion GmbH hatte der EUGH in seinem Urteil vom 19. Mai 2022 unsere Rechtsansichten bestätigt.
Nun hat der Bundesgerichtshof auch für den konkreten Sachverhalt unserer Mandantin, der Heitech Promotion GmbH, Recht gegeben, so dass die Klage der Heitec AG rechtskräftig abgewiesen ist.
Markeninhaber müssen Verletzungen daher spätestens innerhalb von fünf Jahren nachverfolgen, da sonst ihre Ansprüche verwirken, einschließlich Nebenansprüche wie Schadensersatz oder Rückruf. Insbesondere verlängern außergerichtliche Maßnahmen diese Frist nicht, wenn der Markeninhaber nicht innerhalb angemessener Frist zu Gericht geht. Ausführliche Informationen zum Sachverhalt und den Entscheidungsgründen lesen Sie noch einmal hier und in unserem Blogbereich. Beide Entscheidungen werden voraussichtlich die Rechtsprechung der kommenden Jahre für die Frage der Verwirkung im Markenrecht prägen, da höchstrichterliche Entscheidungen, insbesondere unter Einbeziehung des EuGH höchst selten vorkommen.
„Wir freuen uns, dass nun auch der BGH unserer Ansicht gefolgt ist und wir diesen Rechtsstreit nach fast neun Jahren erfolgreich zu Ende bringen konnten“, so Dr. Christof Augenstein. „Es zeigt sich, dass Kather Augenstein auch für komplexe Markenstreitigkeiten eine erste Adresse ist.“
